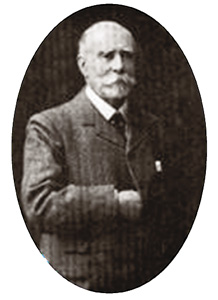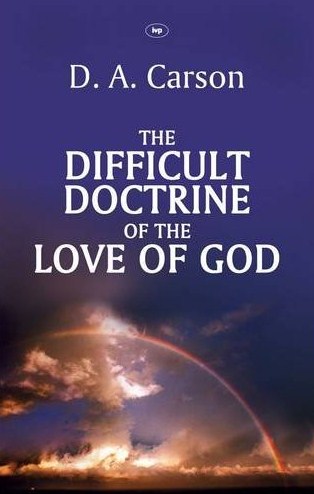Arminianisch denkenden Menschen werfen den „Calvinisten“ oft vor, sie würden das Werk Jesu Christi am Kreuz unzulässig begrenzen und einengen. Dies entnehmen nicht wenige der unglücklichen Bezeichnung „begrenzte Sühnung“ (engl. limited atonement), die als Begriff eine geraume Zeit nach Calvin einem der sog. „Fünf Punkte des Calvinismus“ (den „Lehren der Gnade“ Gottes) zugeordnet wurde. Dieser Vorwurf beruht meistens auf einem Missverständnis, einer Nichtkenntnis oder einem willentlichen Verzerren dessen, was die Reformierten tatsächlich lehr(t)en. Einige verwenden daher lieber trefflichere Bezeichnungen wie „particular redemption“, „definite redemption“, „limited redemption“, „actual atonement“, „intentional atonement“ o. ä.
Angeblicher Höhepunkt des „Calvinismus“ war die Dordrechter Synode der reformierten Kirchen der Niederlande (1618–1619) gegen die „Remonstranten“ (die später oft nicht völlig richtig nach dem Amsterdamer Prediger Jakobus Arminius, späterem Professor in Leiden, „Arminianer“ genannt wurden). Die internationale Synode stellte die sog. „Lehrregeln von Dordrecht“ gegen die Falschlehren der Remonstranten auf. Man beachte, dass es um das zweite Lehrstück geht, nicht das dritte, was das noch später entstandene Akronym TULIP (L für limited atonement) falsch nahelegt:
»Zweites Lehrstück: Vom Tode Christi und der Erlösung der Menschen durch denselben
Die Dordrechter Lehrsätze. 400. Jubiläum der Dordrechter Synode (1618/1619), Reformations-Gesellschaft-Heidelberg e. V. (Hg.), 2019. Fett- und Farbdruck hinzugefügt.
…
Artikel 3
Dieser Tod des Sohnes Gottes ist das einzige und vollkommenste Opfer und Genugtuung für die Sünden, unendlich an Kraft und Wert, überflüssig genügend, die Sünden der ganzen Welt zu sühnen.
Artikel 4
Deshalb ist dieser Tod von so großer Kraft und so großem Wert, weil die Person, welche ihn erlitt, nicht nur ein wahrer und vollkommen heiliger Mensch ist, sondern auch der eingeborene Sohn Gottes, desselben ewigen und unendlichen Wesens mit dem Vater und dem Heiligen Geist, wie unser Heiland sein musste. Sodann, weil sein Tod mit dem Gefühl des Zornes Gottes und des Fluches, den wir durch unsere Sünden verdient hatten, verbunden ist.
Artikel 5
Übrigens ist es die Verheißung des Evangeliums, dass wer an den gekreuzigten Christus glaubt, nicht verlorengeht, sondern das ewige Leben hat. Diese Verheißung muss allen Völkern und Menschen, zu denen Gott das Evangelium nach seinem Wohlgefallen sendet, gemeinschaftlich und ohne Unterschied verkündigt und vorgestellt werden mit dem Befehl zur Buße und zum Glauben.
Artikel 6
Dass aber viele, die durch das Evangelium berufen sind, nicht in sich gehen und nicht an Christus glauben, sondern durch Unglauben umkommen, das geschieht nicht, weil dem am Kreuz dargebrachten Opfer Christi etwas fehlt oder weil es nicht ausreicht, sondern durch ihre eigene Schuld.«
Auswertung. Artikel 3 macht also völlig klar, dass Kraft und Wert des Opfers Christi als unendlich gesehen wird, insofern also nicht als begrenzt verstanden wird. Artikel 4 erklärt dann, dass dieser Wert in der Größe und dem Wert der Person begründet ist, die sich geopfert hat: der Mensch gewordene, heilige, eingeborene Sohn Gottes. Artikel 5 lehrt, dass die Verkündigung der Verheißung dieses Rettungswerks im Evangelium nicht begrenzt werden darf, sondern allen Völkern und Menschen verkündigt und vorgestellt werden muss. Auch hier ist keine Begrenzung, z. B. auf die Erwählten, zu lesen. Artikel 6 macht klar, dass der Unglaube und das Verlorengehen alleine die Schuld des Menschen ist, und niemals im Werk Christi (und irgendeiner Begrenzung dessen) zu finden ist.
Fazit. Die zitierte Lehrregel steht den Falschmeldungen etlicher Autoren und Redner der anti-calvinistischen Szene entlarvend entgegen: Es wird keine Begrenztheit im Wert des Sühnungswerks oder in der Verkündigung der Verheißungen des Evangeliums gelehrt. Auch die Schuldfrage und die Verantwortung des Menschen wird deutlich benannt. Dies entspricht dem klaren Zeugnis der Heiligen Schrift.
Einige beispielhafte Belege reformierter Schreiber
1. Der Reformator Johannes Calvin (1509–1564) – War er eigentlich ein „Calvinist“? – vertrat die alte Formel:
Christus passus est sufficienter pro omnibus, efficaciter [tantum] pro electis.
Zitiert nach: Phillip Schaff, The Creeds of Christendom, Bd. 1, The History of The Creeds, S. 518. Auch Charles Hodge, Systematic Theology (1871; Nachdr., Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans, 1940), Bd. 2, S. 545–46, erwähnt dies als übliche Sicht der sog. Augustinianer. W.G.T. Shedd, Dogmatic Theology, erwähnt es ebenfalls. (Usw.)
Deutsch.: „Christi Leiden ist ausreichend für alle, wirksam [nur] für die Erwählten.“
Weitere Aussagen Calvins über das unbegrenzte Angebot des Opfers Christi finden sich z. B. in seinen teilweise überraschenden Kommentaren zu Johannes 3,16 und Römer 5,18 (s. u.).
2. Der nach Amerika ausgewanderte niederländische reformierte Theologe Rienk B. Kuiper (1886–1966) ist ein Beispiel dafür, dass „die Calvinisten“ eben nicht in jeder Hinsicht die Absichten und Wirkungen des Sühnungswerks Christi auf die Erwählten begrenzen. Er schrieb in seinem Buch For Whom Did Christ Die?:
»According to the Reformed faith the divine design of the atonement is in an important respect limited. But the Reformed faith also insists that in other respects it is universal. It can be shown without the slightest difficulty that certain benefits of the atonement, other than the salvation of individuals, are universal.
R. B. Kuiper, For Whom Did Christ Die?: A Study of the Divine Design of the Atonement (Wm. B. Eerdmans, 1959; Nachdr., Wipf and Stock, 2003), S. 78–79 (Kapitel 5 „Scriptural Universalism“). Fett- und Farbschrift hinzugefügt, Kursiv im Original.
Therefore the statement, so often heard from Reformed pulpits, that Christ died only for the elect must be rated a careless one. To be sure, if by „for“ be meant in the place of, the statement is accurate enough … If, however, by „for“ be meant in behalf of, it is inaccurate, to say the least. Certain benefits of the atonement accrue to men generally, including the non-elect. Like all things that are, this is so by divine design.«
3. Der amerikanische reformierte Theologe Loraine Boettner (1901–1990) schrieb 1932 in seinem Buch The Reformed Doctrine of Predestination, das aus seiner Masterarbeit (Th.M.) am Princeton Theological Seminary entstand, dass die Sühnung (Atonement) „streng genommen“ ein „unbegrenzter Vorgang“ ist, deren Anwendung jedoch (in Form der Erlösung, also der Vergebung der Sünden und Befreiung vom daraus entstandenen Fluch; Eph 1,7; Röm 3,24; Gal 3,13; 1.Pet 1,18–19 u. a.) begrenzt ist:
»The question which we are to discuss under the subject of „Limited Atonement“ is, Did Christ offer up Himself a sacrifice for the whole human race, for every individual without distinction or exception; or did His death have special reference to the elect? In other words, was the sacrifice of Christ merely intended to make the salvation of all men possible, or was it intended to render certain the salvation of those who had been given to Him by the Father? Arminians hold that Christ died for all men alike, while Calvinists hold that in the intention and secret plan of God Christ died for the elect only, and that His death had only an incidental [beiläufige] reference to others in so far as they are partakers of common grace. The meaning might be brought out more clearly if we used the phrase „Limited Redemption“ rather than „Limited Atonement.“ The Atonement is, of course, strictly an infinite transaction; the limitation comes in, theologically, in the application of the benefits of the atonement, that is in redemption. But since the phrase „Limited Atonement“ has become well established in theological usage and its meaning is well known we shall continue to use it.«
Loraine Boettner, The Reformed Doctrine Of Predestination, Thirtieth printing 1989 (Phillipsburg, NJ: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1932), S. 150 (Kapitel 12 „Limited Atonement“). Fett- und Farbschrift sowie Text in eckigen Klammern hinzugefügt.
Kommentar: Die vom reformierten Theologen Boettner getroffene Unterscheidung zwischen der universalen Sühnung und der definitiven, begrenzten Erlösung (o. Vergebung, Stellvertretung im Gericht usw.) bzgl. des Opfers Jesu haben etliche Autoren der „Plymouth Brüder“ (in D.: Elberfelder Brüderbewegung) früher exklusiv für sich reklamiert. Man bewertet dies heute als ihren kreativ-theologischen Beitrag zur Soteriologie (Heilslehre) des 19. Jahrhunderts (s. z. B. Mark R. Stevenson in The Doctrines of Grace in an Unexpected Place, 2017). Wenn allerdings heute immer noch behauptet wird (meist durch ungeprüftes und unreflektiertes Abschreiben aus alten Quellen, wie z. B. den Schriften der Cheftheologen der „Brüderbewegung“, John N. Darby und Wm. Kelly): »Während Calvinisten in der Sühnung häufig nur den Aspekt der Stellvertretung sehen…«, oder: »Die calvinistisch geprägte Vorstellung von Sühnung kennt die Seite der Genugtuung oder dass Gott im Hinblick auf die ganze Welt unbegrenzt zufriedengestellt wurde, nicht.« (Dirk Schürmann auf soundwords.de [2015, 2021]), irrt jedoch, wie oben gezeigt. Man sollte nicht Dinge behaupten oder gar bewerten, die man nicht studiert hat oder die völlig veraltet sind.
Eine unsaubere Terminologie der Heilsbegriffe stiftet zudem manches Missverständnis: Mal redet man von Sühnung, mal von Versöhnung, Erlösungswerk, Opfer Jesu, Vergebung, Errettung, Heil usw. Diese Begriffe bezeichnen jedoch zumeist unterschiedliche Aspekte des Werkes Jesu am Kreuz. Wenn die Begriffe aber nicht geklärt sind, ist das Gesagte (Geschriebene) oft nicht das Gemeinte und – fataler Weise – nicht das Verstandene. Beachtet werden muss auch, dass die Heilige Schrift diese Begriffe nicht immer gleichartig verwendet. Um den Sinn eines Begriffs an einer Stelle zu erfassen, muss vor allem der Kontext aufmerksam beachtet werden, reine „Wortstudien“ oder konkordante Vergleiche und Gleichsetzungen reichen nicht aus. Stevenson beobachtete auch bei dem erwähnten Theologen der frühen „Brüderbewegung“ (Plymouth Brethren), John N. Darby (1800–1882), dass dieser sein Verständnis in der Heilslehre schärfen und entsprechend Nuancen beachten musste. Stevenson sieht es daher als notwendig an, in der Soteriologie (Heilslehre) den „Calvinismus“ der „Brüder“ und vieler reformierter Theologen vom unbiblischen „Hyper-Calvinismus“ strikt zu trennen:
»As Darby’s views developed, his position on the atonement became more nuanced. He made a crucial distinction between propitiation and substitution. Propitiation is Godward and thus in the work of Christ there is ‘an adequate and available sacrifice for sin for whoever would come.’61 But Darby did not believe that Christ bore, as a substitute, the sins of all people. He wrote, ‘I can address all, and declare to them that this satisfaction [for sin] has been made… But I cannot say to all that Christ bore their sins, because the word does not say it anywhere. If He had borne their sins, they would certainly be justified.’62 Darby explained how this impacted his preaching, ‘I can say to all, that propitiation has been presented to God. They have but to look there, and going to God by that blood they will be received; they have nothing to wait for. They will not go unless the Father draw them, but this is a matter of sovereign grace, with which I have nothing to do in my preaching—in my teaching, yes, but not in my address to unconverted souls.’63 It is reasonable to conclude that Darby was a strict Calvinist who saw a particularity in the atonement but did not share the hyper-Calvinist refusal of a universal gospel offer.«
Mark R. Stevenson, „Early Brethren Leaders and the Question of Calvinism“, in: Brethren Historical Review 6:2–33 [2010]. – FN61: »[Darby], CW, 29, p.287.«; FN62: »[Darby], Letters, vol.1, p.98.«; FN63: »Ibid.«. Fett- und Farbdruck hinzugefügt. Link zu einem PDF-Exzerpt.
Weitere Untersuchungen
Eine weitere Untersuchung könnte sich der Frage widmen, inwiefern die Wirksamkeit und effektiven Anwendung der Sühnung begrenzt ist. Denn begrenzt ist sie, wenn wir den klaren Lehren Jesu und seiner Apostel folgend nicht an die Irrlehre der Allversöhnung (sog. Universalismus) glauben.
Die eher „calvinistische“ Deutung sieht das Sühnungswerk (Boettner folgend genauer gesagt: die Erlösung, also die Anwendung) Jesu in Zielsetzung und Absicht (engl. purpose) begrenzt, zumindest im Aspekt der persönlichen Stellvertretung im Gericht, die nur für die Erwählten stattfand und diese effektiv rettete. Dies ist auch die traditionelle Position der „Brüderbewegung“ (Plymouth Brethren, KLC Brethren), die allerdings immer mehr in Richtung arminianischer Falschlehren verlassen wurde und wird.
Die eher „arminianische“ Deutung hingegen begrenzt die Wirksamkeit des Sühnungswerkes Christi auch, aber nun vielmehr darin, dass dieses Sühnungswerk die Rettung von Menschen nur möglich mache („Die Tür aufstieß“, eine/n Chance/Weg eröffnete), aber die Rettung keines einzigen Menschen effektiv vollbrachte. Jeder sollte einmal die Heilige Schrift unter Gebet studieren, um zu verstehen, was Christus gemeint hatte, als Er am Kreuz ausrief: „Tetélestai! – Es ist vollbracht!“
Quellen
- Die Dordrechter Lehrsätze. 400. Jubiläum der Dordrechter Synode (1618/1619), Reformations-Gesellschaft-Heidelberg e. V. (Hg.), 2019. Download: https://reformationsgesellschaft.de/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-04-Dordrechter-Lehrsaetze-WEB.pdf [10.08.2020]
- Calvin über Römer 5,18: https://www.ccel.org/c/calvin/comment3/comm_vol38/htm/ix.x.htm, http://www.calvinismus.ch/wp-content/uploads/roemer.html
»Christi Gerechtigkeit und Gehorsam kam nicht seiner Person allein zugute, sondern greift weit darüber hinaus und macht die Gläubigen reich, welche sie zum Geschenk empfangen. Ein Gemeinbesitz für alle Menschen ist die Gnade nun deshalb, weil sie für alle öffentlich ausgeboten ward, nicht etwa weil alle sie wirklich hinnähmen. Christus hat zwar für die Sünden der ganzen Welt gelitten, und alle empfangen unterschiedslos das Angebot der Güte Gottes: aber nicht alle nehmen es an.« - Calvin über Johannes 3,16: https://www.ccel.org/c/calvin/comment3/comm_vol34/htm/ix.iii.htm
»That whosoever believeth on him may not perish. It is a remarkable commendation of faith, that it frees us from everlasting destruction. For he intended expressly to state that, though we appear to have been born to death, undoubted deliverance is offered to us by the faith of Christ; and, therefore, that we ought not to fear death, which otherwise hangs over us. And he has employed the universal term whosoever, both to invite all indiscriminately to partake of life, and to cut off every excuse from unbelievers. Such is also the import of the term World, which he formerly used; for though nothing will be found in the world that is worthy of the favor of God, yet he shows himself to be reconciled to the whole world, when he invites all men without exception to the faith of Christ, which is nothing else than an entrance into life.«