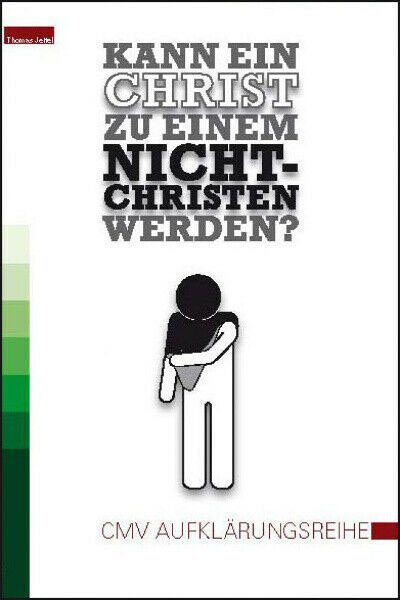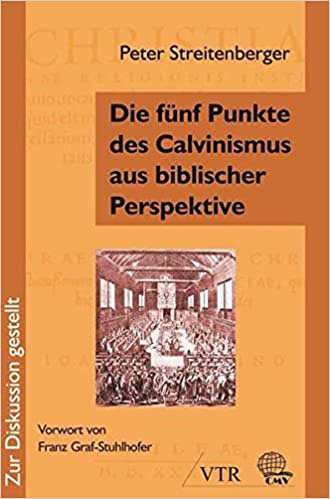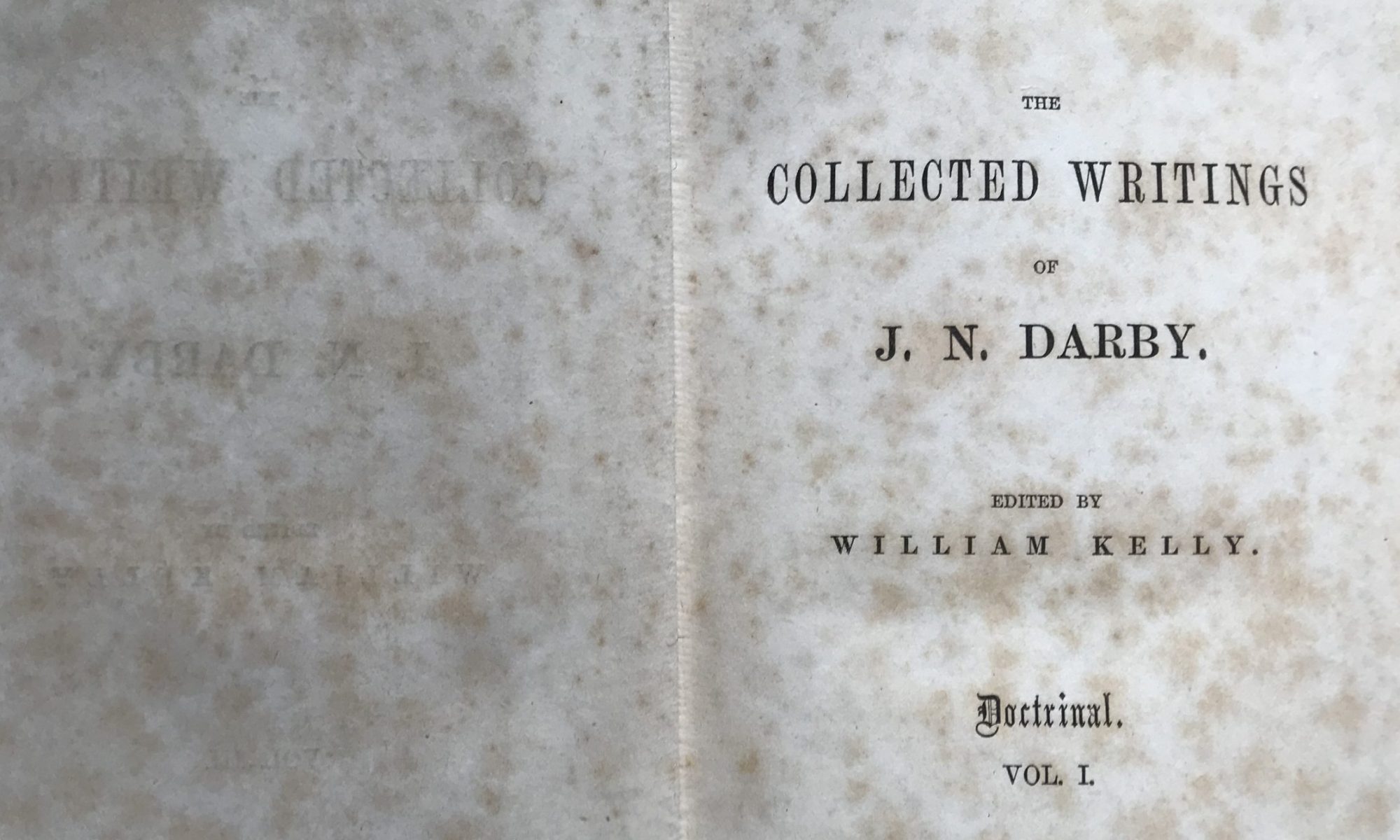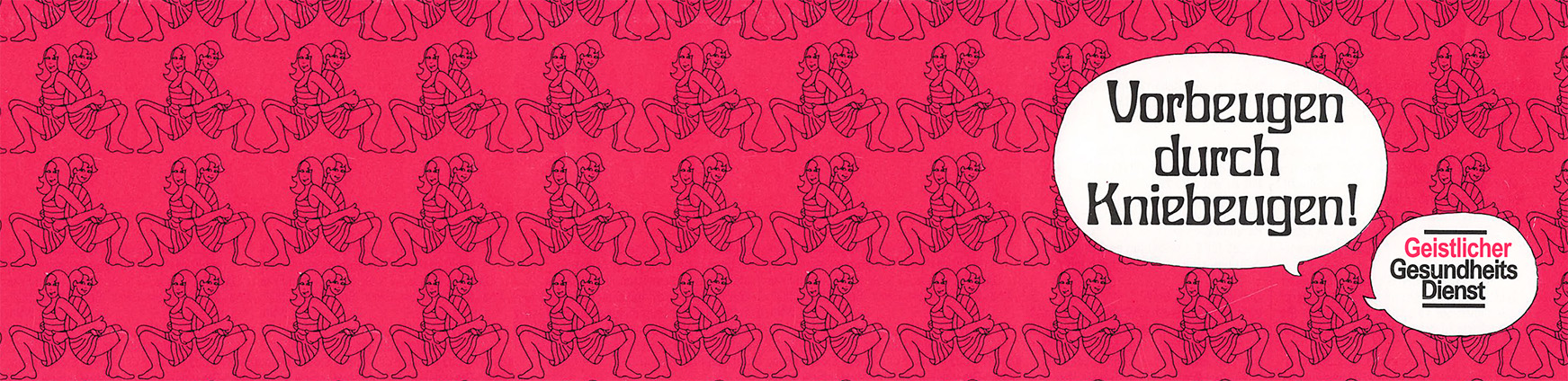Der Apostel Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus:
Denn Gott ist einer, und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, [der] Mensch Christus Jesus, der sich selbst gab als Lösegeld für alle…
1. Timotheus 2,5-6 (ELBCSV). Fettdruck hinzugefügt.
Wenn Christus das Lösegeld für alle gegeben hat, sind dann nicht alle Menschen erlöst? Es heißt doch direkt zuvor, wenn auch etwas erstaunlich formuliert (keine Tat Gottes, nur eine Willensbekundung; keine aktive, sondern passive Sprache: „errettet werden“ usw.):
Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Heiland-Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
1. Timotheus 2,3-4 (ELBCSV). Fettdruck hinzugefügt.
Warum reden aber sowohl Jesus Christus als auch Seine Apostel davon, dass viele den Weg ins Verderben gehen und nicht alle Teil an der Errettung haben? Wir gehen davon aus, dass die Heilige Schrift widerspruchsfrei ist. Also müssen wir anfangen, in den Linien der Bibel nachzudenken.
Inwieweit wirkt das Sühnungswerk Christi am Kreuz mit Blick auf alle Menschen, und inwieweit wirkt es effektiv nur auf einen begrenzten Kreis von Menschen?
Hier unterscheiden sich katholische und protestantische Ansichten und Lehrmeinungen. Im reformatorischen Bereich herrschen ebenfalls sehr unterschiedliche Lehrmeinungen vor.
Ein Teil dieser Missverständnisse und resultierenden Widersprüche beruhen auf einem unvollkommenen Verständnis dessen, was am Kreuz passiert ist. Gott hat über Jahrtausende hinweg in Typen und Verordnungen vorbereitet, das Werk Christi in seiner Vielfalt und Fülle verstehen zu können. Im Alten Bund feierte Israel unterschiedliche Feste, die alle mit Opfern verbunden waren. Eine Handvoll unterschiedlicher Opfer waren zudem verordnet worden, mit denen man der Frage der Sünde, aber auch der Verehrung Gottes, gottgefällig nachkommen konnte.
Ein jährliches Fest sticht besonders heraus: der Große Sühnungstag (auch Großer Versöhnungstag oder Yom Hakippurim genannt). Es wird in 3. Mose 16 beschrieben. An diesem Tag opferte der Hohepriester des Volkes stellvertretend für das ganze Volk ein Doppelopfer zweier Ziegenböcke.
Der erste Bock, „für JHWH“ (den Ewigen), wird durch Los ermittelt. Er wird als Opfer getötet, sein Blut wird in das Allerheiligste des Tabernakels (Tempels) vor Gott gebracht und auf den „Sühndeckel“ der Bundeslade gesprengt. In der Bundeslade lagen die beiden Gesetzestafeln, das Zehnwort (Dekalog), welche Gottes heilige Ansprüche an das Volk formulierten. Gott thronte auf dieser Bundeslade. Beim Blick in Richtung der Gesetzestafeln sah Gott das Blut, es „sprach“ also in Gottes Gegenwart vom gebrachten Opfer, vom gestorbenen Stellvertreter. Dieser Teil des Rituals wurde durchgeführt, ohne dass von spezifischen Sünden des Volkes die Rede war, oder solche dem Bock durch Handauflegung übertragen worden waren. Es ging erst einmal darum, dass Gott durch den Tod (des Stellvertreters) befriedigt und geehrt wurde: seine Heiligkeit -und mithin sein Zorn über die Sünde- wurden plakativ demonstriert und durch Tod des Sünders (oder seines stellvertretenden Opfers) bedeckt.
Der zweite Bock, Asasel (hebr. für „Abwendung“), wird nicht getötet. Auf sein Haupt bekennt der Hohepriester die Sünden des Volkes. Anschließend wird der Bock in die Wüste gejagt an einen Ort, von wo er nicht mehr zurückfindet ins Lager des Volkes. Das Sinnbild ist klar: Die Sündenmenge wird durch das stellvertretende Opfer aus der Mitte des Volkes weggenommen. Das erinnert an Psalm 103,12: »so weit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen«, den Propheten Micha 7,19: »du wirst alle ihre Sünden in die Tiefen des Meeres werfen« oder Jeremia 31,34: »Denn ich werde ihre Schuld vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken« mit den neutestamentlichen Zitaten in Hebräer: »Ihrer Sünden und ihrer Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken.« (8,12, vgl. 10,17). Das Ziel der Sühnung ist, dass die Sünden der Gesühnten nie mehr zum Trennungsgrund oder belastenden, bedrohlichen Gesprächsthema zwischen Gott und Mensch werden. Der gesühnte Mensch darf aufatmen und Frieden mit Gott erfahren.
Zwei Böcke – ein Opfer. Nun sind beide Böcke und die beiden Handlungen damit typologisch in dem einen Werk Christi vollkommen, effektiv und gleichzeitig realisiert worden. Trotzdem dienen diese beiden Böcke dazu, dass wir zwei Aspekte des einen Opfers Christi unterscheiden können.
Erster Bock. Christus starb also zuallererst, um die Sache der Beleidigung und Herausforderung der Heiligkeit und Majestät Gottes, wie sie durch die Sünde des Menschen geschieht, zu klären. Diese Klärung bedurfte des Todes, das Blut des Opfers musste vor Gott gebracht werden. Der Hebräerbrief liefert die verbindliche Interpretation dieses Typus auf Christus hin, er ist eine großartige Erklärung des „Großen Sühnungstages“:
Christus aber – gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter, in Verbindung mit der größeren und vollkommeneren Hütte, die nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut – ist ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen, als er eine ewige Erlösung erfunden hatte.
Hebräer 9,11-12 (ELBCSV). Fettdruck hinzugefügt.
Zweiter Bock. Nachdem diese Sache mit Gott geklärt worden war, also Gottes Heiligkeit demonstriert und sein Zorn bedeckt wurde, wendet sich das Opferritual auch den konkreten Menschen im Volk Gottes und deren Sünden zu. Das Problem der von Sünden belasteten Gewissen musste angesprochen werden. Und so wird nun im zweiten Bock erstmals die Frage der Sünde konkret angesprochen in Handauflegung und Bekenntnis. Das Bekenntnis leistet der Hohepriester stellvertretend und wirksam für die von ihm vertretenen Menschen des Volkes Gottes. Dann wird der Bock aus dem Mitte entfernt und so auch die auf ihn gelegten Sünden weggeschafft. Typologisch wurde damit vorgeschattet, dass das »Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat, euer Gewissen […] von toten Werken, um dem lebendigen Gott zu dienen!« (Hebräer 9,14 ELBCSV) reinigt. Es entlastet und befreit zum Gottesdienst. Dass dieses an zweiter Stelle erst kommen kann, nachdem zuerst die Sache betreffs des heiligen Zornes Gottes geklärt wurde, ist einleuchtend für alle, die dem biblischen Evangelium glauben.
Ein paar hilfreiche theologische Begriffe
Der erste Bock, der für den HERRN, stellt den Aspekt der Sühnung in ihrem Gott zugewandten Aspekt dar (Fachwort: Propitiation). Hier geht es um Gottes Seite, dass Gott durch die Sünde des Menschen beleidigt wurde, dass diese Sünde eine generelle Barriere zwischen Gott und Mensch aufgebaut hat (vgl. Jesaja 59,2). Daher bedurfte es des einen Mittlers, von dem in 1. Timotheus 2,5 die Rede ist. Sühnung bedeckt also den gerechten Zorn Gottes gegenüber dem rebellischen, sündigen Menschen mit dem Blut (als Beweis des Todes) des Opfers. Aufgrund dessen kann Gott nun in Retterliebe in Christus dem Menschen nahen und ihm im Evangelium ein Friedens- und Versöhnungsangebot in Christus machen (Gott verlangt allerdings die bedingungslose Kapitulation!):
So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte; wir bitten an Christi statt: Lasst euch versöhnen mit Gott!
2. Korinther 5,20 (ELBCSV) – Auf den Unterschied zwischen Sühnung und Versöhnung gehen wir hier nicht ein.
Durch den zweiten Bock, den der Abwendung, und das Ritual damit, wird uns vermittelt, dass die Heiligkeit Gottes als gerechte Strafe verlangt, dass jeder Sünder für seine persönlichen Sünden den ewigen Tod im Gericht Gottes erleiden muss. Für den an Christus Glaubenden rechnet Gott jedoch gnädig den Tod Seines Sohnes an. In diesem Fall übernimmt Christus die Sünden dieser/s Glaubenden und stirbt stellvertretend für sie/ihn (strafrechtliche Stellvertretung; engl. penal substitution). Dies ist der dem glaubenden Menschen zugewandte Aspekt der Sühnung (Fachwort: Expiation). Stellvertretung ist eine An-Stelle-von-Beziehung: Einer tritt aus Liebe an die Stelle eines anderen (Galater 2,20) oder einer definierten Gruppe („Gemeinde“, Epheser 5,25). Diese Stellvertretung durch Christus wird im Neuen Testament stets nur zugunsten der Glaubenden gelehrt. Die Ansicht (z. B. des neo-orthodoxen Theologen Karl Barth), dass Christus als Repräsentant und damit auch als Stellvertreter der gesamten Menschheit im Gericht Gottes am Kreuz gewesen sei, ist falsch, sie führt unausweichlich zur Irrlehre der Allversöhnung (Universalismus).
Gottgewandte Sühnung und menschgewandte Sühnung, Genugtuung und Stellvertretung, Propitiation und Expiation, sind also zwei gut zu unterscheidende Begriffe und Sachverhalte im Opfer des Großen Sühnungstages, auch wenn beides in dem einen Opfer Jesu am Kreuz zu sehen und insofern zusammenzuhalten ist.
Damit wird auch deutlich, dass es stets eine korporative Seite und eine persönliche Seite des Opferwerkes Jesu gibt. Jesus starb sühnend mit Blick auf die ganze Welt, aber er starb stellvertretend effektiv (nur) für einzelne Menschen. Betont oder sieht man nur eine Seite, wird man einseitig:
- Menschen, die von arminianischer Theologie beeinflusst sind, neigen dazu, nur die allgemeine Seite des Sühnungsopfers Jesu zu sehen, welche mit Blick auf alle Menschen geschehen ist.
- Menschen, die von calvinistischer Theologie beeinflusst sind, neigen dazu, nur die stellvertretende Seite des Sühnungsopfers Jesu zu sehen, welche eben nicht alle Menschen umfasst, sondern nur die zum Heil göttlich Erwählten.
Die beiden Haupttheologen der „Brüderbewegung“, John N. Darby und William Kelly, haben im 19. Jahrhundert hierzu Hilfreiches geschrieben. Hier ein Exzerpt von Darby:
Die Arminianer sehen in dem Tod Christi nichts weiter als ein Opfer für alle und verbinden damit gewöhnlich auf allgemeine Weise das Tragen der Sünden. Dadurch wird alles unklar in Bezug darauf, dass Christus die Sünden des Einzelnen wirklich und vollgültig getragen oder ein besonderes Werk für die Seinigen getan hat. Sie sagen, dass, wenn Gott alle liebte, Er nicht einige insbesondere lieben konnte. Die Errettung wird somit unsicher gemacht und der Mensch nicht selten erhoben, während die Lehre des Vorbildes, die wir in dem Bock der Abwendung haben, gänzlich außer Acht gelassen wird.
Die Calvinisten dagegen halten fest daran, dass Christus die Sünden der Seinigen getragen habe und ihre Errettung somit ganz gewiss sei. Sie bleiben aber bei dem Schluss stehen, dass, wenn Er die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben habe, seine Liebe außer ihr keinen anderen Gegenstand gehabt haben könne. Sie übersehen den unverkennbaren Charakter der Sühnung, sein Sterben für alle und alles. Sie sehen nur die Stellvertretung und berücksichtigen nicht die Bedeutung des Blutes auf dem Gnadenstuhl [d. h. des Blutes des Bockes für den Herrn].
Genau genommen lesen wir von Christus nie, dass Er die Welt, sondern dass Er die Versammlung geliebt hat, und zwar mit der Liebe eines besonderen Verhältnisses (Eph 5). Von Gott dagegen heißt es nie, dass Er die Versammlung, sondern dass Er die Welt geliebt hat (Joh 3,16), was seiner göttlichen Güte entsprach, seiner göttlichen Natur angemessen war; sein Ratschluss aber ist etwas anderes. Seine Herrlichkeit ist das Endziel von allem.
Ohne mich aber dabei aufzuhalten, möchte ich nur darauf hinweisen, welch eine Verwirrung unklare Begriffe über Sühnung und Stellvertretung in der Verkündigung des Evangeliums hervorbringen müssen, indem sie den Ruf an die Welt schwächen oder die Sicherheit des Gläubigen zweifelhaft erscheinen lassen und der Verkündigung der Wahrheit im Allgemeinen Sicherheit und Bestimmtheit rauben.
John N. Darby: Die zwei Seiten der Sühnung. Eigentlich: Sühnung und Stellvertretung. In: Halte fest, Jg. 28 (1985), S. 285ff. Deutsche Textquelle online: https://www.soundwords.de/a956.html [11.08.2020] – Was Darby damals als „Calvinisten“ bezeichnete, würde man heute differenzierter dem Hyper-Calvinismus zuordnen.
Leseempfehlungen
Eine gute Einführung und Erklärung der Rituale und Opfer am „Großen Sühnungstag“ und ihre Erfüllung im Opfer Jesu Christi liefern Bruno Oberhänsli und Willem Ouweneel. Als Angehörige der englischen „Brüderbewegung“ folgen sie im wesentlichen deren Haupttheologen John N. Darby und William Kelly.