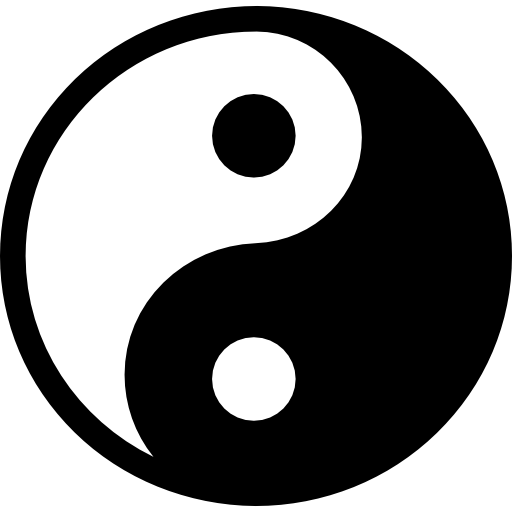Ein Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Uwe A. Seidel in Böblingen am 17.3.2001[1]
Der Ausdruck »christliche Technik« erscheint manchem Zeitgenossen als Widerspruch. Kann Technik überhaupt christlich sein? Technologien sind doch wohl wertfrei, allenfalls ambivalent, können also gute und schlechte Werte tragen.
Begriffsklärung
Der Begriff der Technik ist jedem Ingenieur geläufig. In einer bekannten Richtlinie des VDI (RL 3780[2]) werden mit „Technik“ einerseits Geräte und Sachsysteme bezeichnet, andererseits auch das menschliche Handeln zum Entstehen solcher Sachsysteme und das Handeln unter Verwendung dieser Sachsysteme. Was aber könnte »christliche Technik« genannt werden? Vielleicht kann man darunter eine Technik verstehen, wenn
- die Planer, Gestalter und Erzeuger von Technik Christen sind,
- die Benutzer Christen sind, sie also für Christen betrieben wird,
- diese Technik mit christlichen Wertvorstellungen verträglich ist, oder
- die Technik christlichen Zielen dient.
Diese vier Definitionen fügen sich sinnvoll aneinander, wenn man »christliche Technik« teleologisch versteht, also vom Ziel oder Ende her, das erreicht werden will. Während also die Technik selbst noch kein Maßstab für Christlichkeit ist, ließe sich vom Ziel her, auf das eine Technik hinführt, entscheiden, ob sie christlich ist oder nicht. Zum Beispiel könnte jemand das Telefon verwenden, um üble Nachrede zu verbreiten oder aber, um seelsorgerliche Gespräche zu führen. Der technisch Handelnde muss gefragt werden: Welches Ziel verfolgst Du? Worauf sollte alles hinauslaufen? Darum lautet eine mögliche Definition, die wir hier als Arbeitsdefinition verwenden wollen:
Technik ist dann christlich, wenn ihr Einsatz christlichen Werten entspricht, christlich vertretbare Ziele anstrebt und Christen sie mit dieser Kenntnis entwerfen, gestalten und einsetzen.
Um urteilen zu können, benötigt man abgestufte Werte für gut und böse, wahr und unwahr. Woher kommen diese, wer setzt die Normen? Gott tut es. Er setzt als letzte Autorität Gebote und Verbote. Darüber hinaus verpackt er seine Aussagen meistens in Geschichte. Ein großer Teil der Bibel (ca. 40 %) ist Erzählung und Lebensbeschreibung – von einzelnen Menschen, von Völkern und ihrer Geschichte. Dabei sollten die Werte des Gesetzes Gottes (5. Mose 4f) von einer Generation zur anderen weitergegeben werden. Das Neue Testament beginnt mit vier Porträts, die zusammen die Lebensbeschreibung Jesu ergeben. Auch die Apostelgeschichte ist historisch und geistliche Erzählung der Ausbreitung des Christentums. Und dann kommen Lehrbriefe, die teilweise zwar recht abstrakt über Lehre und christliche Normen sprechen, aber auch wieder sehr persönliche Briefe sind, die in geschichtlich relevante Situationen sehr praktisch hineinsprechen. Im Folgenden sollen einige Bibeltexte zum Nachdenken über christliche Technik vorgelegt werden.
Das Ebenbild
Am Anfang beschreibt das erste Buch Mose, die »Genesis«, den Menschen als Geschöpf Gottes, hineingesetzt in eine Schöpfung. Diese Glaubensaussagen setzen Ereignisse voraus, die niemand beobachtet hat. Woher verstehen wir dann aber, dass Gott die Welt gemacht hat?
Erstens durch die Schöpfung selbst; an ihr sehen wir Gottes unendliche Kraft und Weisheit (Römer 1,20). Zweitensdurch den Glauben, dass Gott sprach und es dann da war (Hebräer 11,3). Das kann man weder naturwissenschaftlich durch Wiederholung im Versuch beweisen noch juristisch, etwa durch Zeugen. Aber es gibt manche Hinweise, nämlich Forschungsaussagen von Biologen und Paläontologen. Die Genesis erklärt also: Der Mensch ist zuerst einmal nicht selber Gott. Die Renaissance hat das Gegenteil behauptet. Sie redete den Menschen ein, sie könnten durch Ausnutzung der Technik Götter werden, nach dem Motto: »Es gibt keinen Gott außer dir – du musst zu dir selbst finden.« Davon muss ein christliches Weltbild Abstand nehmen.
Aber was ist dann der Mensch? Er ist »Ebenbild« Gottes und dessen Stellvertreter auf Erden. Der Ausdruck »zum Bilde Gottes und in seinem Gleichnis« (1. Mose 1,27) beinhaltet zwei Aspekte: eine gewisse Ähnlichkeit mit Gott und eine repräsentative Aufgabenstellung von ihm. So hat der Mensch moralische Ähnlichkeit mit Gott und weiß ausnahmslos von Gut und Böse. Er ist zudem ein vernunftbegabtes, kreatives Wesen. Forscher beobachten die Natur und versuchen zu verstehen, was Gott gemacht hat und wie es »funktioniert«, Ingenieure versuchen dies dann in technischen Systemen umzusetzen. Das ist besonders im Bereich der Bionik und Biotechnik beeindruckend belegt: Das Fliegen hat man sich von den Vögeln und Insekten abgeschaut. Von der Haifischhaut profitieren Flugzeuge, Skiflieger und Schwimmer, denn eine entsprechend rauhe Außenhaut besitzt geringe Reibungswiderstände als eine glatte Haut. Seit man erforschte, warum die Lotusblüten nie schmutzig werden, gibt es Fassaden, Bekleidungsstoffe und Werkzeuge, von denen Wasser oder Schmutz abperlt. So lernen die kleinen, kreatürlichen »Kreativen« von ihrem ganz großen Schöpfer.
Aber »Bild« meint auch Repräsentation. Wir vertreten Gott in seiner irdischen Schöpfung. So sind wir Menschen Verwalter, aber nicht Eigentümer der Dinge. Das heißt, wir sind in Verantwortung gesetzt. Dies begrenzt und orientiert unseren Umgang mit Gottes Gaben in Natur, Kultur und Technik. Damit, dass alle Menschen aus der Hand des Schöpfers hervorgegangen und nicht durch blinden Zufall da sind, wird ihnen allen ohne Unterschied auch Würde zugesprochen. Alle Menschen sind von Würde und Wert, weil sie von Gott gewollt sind und nicht, wie Jacques Monod sagt, von den Göttern der Evolution, »Zufall und Notwendigkeit«, abstammen. Zusammen mit der göttlich verliehenen Würde als Bilder Gottes möchte Gott auch eine Beziehung zu uns aufbauen und durch Kommunikation pflegen. Er selbst möchte mit den Menschen kommunizieren und will, dass sie es miteinander tun. Deswegen hat er ihnen »Geist« und differenzierte Sprachfähigkeit gegeben, im Gegensatz zu Tieren.
Diese Erklärungen sind für die Praxis bedeutsam. Technologie, die die Gemeinschaft der Menschen oder ihre Kommunikationsfähigkeit untergräbt oder hindert, ist mit christlichen Werten unvereinbar. Technologie, die Menschen minderwertig macht und versklavt, darf nicht eingesetzt werden. Hier besteht eine riesige Herausforderung für Christen, nämlich mit den technischen Möglichkeiten richtig umzugehen, sowie die entsprechende Bildung zu fördern.
Der Kulturauftrag
Gott erteilte dem Menschen den sog. Kulturauftrag: »Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren« (1. Mose 2,15). Damit setzt Gott den Menschen in Verantwortung zu sich, dem Schöpfer. Der Mensch ist von der Natur und dem Mitmenschen abhängig; denn die Natur hat er sich nicht selbst gemacht, sondern er wird in diese göttliche Schöpfung hinein »gesetzt«. Adam kam hinzu, nachdem fünfeinhalb Tage lang schon einiges geschehen war, auf das er keinen Einfluss und von dem er nichts beobachtet hatte. Erst recht nicht war er Gottes Berater. Diesen kategorialen Unterschied zwischen dem Schöpfergott und allen geschaffenen Wesen und Dingen zu bedenken, wird schon Hiob aufgefordert: »Wo warst du, als ich die Erde gründete? Tu es kund, wenn du Einsicht besitzt!« (Hiob 38,4).
Die Grenze
Wir sind also in Vorgegebenes hineingeboren und darauf angewiesen. Dazu zählt auch, dass Gott den Menschen zur Gemeinschaft mit seinesgleichen verpflichtet, indem er Adam mit Eva verbindet. Auch ist der Mensch endlich, denn indem er in den Garten Eden gesetzt wird, sind ihm zugleich Grenzen gesetzt. Offensichtlich war Eden ein umzäunter Garten (Garten als intelligent gestaltete Natur), jedenfalls bestand eine deutliche Markierung. Diese trug geistig-moralische Bedeutung, nämlich sinngemäß: »Ich gebe dir Grenzen, um dir zu zeigen, dass du Verwalter bist, aber kein souveräner Herrscher. Denn der Schöpfer bin ich. Aber dich setze ich als mein Bild, meinen Repräsentanten, ein, um alles zu gestalten, zu verwalten und zu bewahren.«
Die Grenze zeigt Gott auch mit dem »du sollst…« und »du sollst nicht…« auf. Er erteilt Gebote. Fast 100 % aller Baumfrüchte durfte gegessen werden, nur von einem Baum sollte nicht gegessen werden. Dieser stand im Mittelpunkt des Gartens (1. Mose 3,3). Die Grenze war, richtig verstanden, nicht dazu da, um den Menschen zu ärgern, ihm Gottes Segen zu schmälern oder irgendwie Glück zu verhindern. Vielmehr sollte dem Menschen stets bewusst sein, dass über ihm der steht, der absolute Grenzen setzen kann. Das Misstrauen zu Gott als dem Grenzenzieher hat dann die Schlange gesät. Wir kennen den Ausgang der Geschichte. Sie ist unser aller Geschichte. Aber mit den Grenzen, die Gott gezogen hat, hat er einen Segensraum aufgerichtet. Wer diesen durch »Übertretung« verlässt, tritt ins Elend (Römer 5,14).
Wenn man mit diesem Wissen um die Gebote Gottes an das Thema »Christliche Technik« herangeht, sieht man, dass Gott uns durch diese Eingrenzung einen Entfaltungsraum gibt. Der Zeitgeist behauptet dagegen: »Du brauchst genau die Dinge, die Gott dir verbietet.« Doch im Glauben antworten wir: »Nein, wir brauchen sie nicht.« Denn durch die Gebote werden wir zu Menschen, die sich unter Gottes Segen entfalten können. In technologischen und anderen Bereichen gibt es viele verbotene Früchte. Jesus Christus hat viel von Sünde, Hölle und Verderben als von Realitäten gesprochen. Ein Christ lässt sich das sagen und macht auch andere Menschen darauf aufmerksam, dass etwas Schlimmes auf sie wartet. Dies zu tun ist etwas sehr Positives; denn wer andere nicht vor einer Gefahr warnt, macht sich schuldig. Wer über Gebote und Grenzen spricht, muss auch über Sünde und ewiges Gericht sprechen. Damit macht er klar, dass ein bestimmtes Verhalten oder ein bestimmter Umgang zur Belohnung oder Bestrafung führen, zum ultimativen Segen oder zum ewigen Fluch. Im Gegensatz zu Gott sind dem Menschen also Grenzen gesetzt, vor deren Übertretung Gott ernsthaft warnt.
Der Gescheiterte
Wer über den Zusammenhang von Technik und Christ spricht, muss auch über das Geschehnis des Sündenfalls reden. Der Mensch ist nicht mehr so gut, wie er aus Gottes Hand hervorgekommen ist. Nach meiner Überzeugung ist der Sündenfallbericht (1. Mose 3) genauso wie der Schöpfungsbericht historischer Fakt und kein Mythos. Er ist historisch und heilsgeschichtlich Wahrheit.
Was ist daraus zu lernen? Daraus ist vor allem zu lernen, dass menschliches Handeln misslingen kann, sowohl willentlich als auch versehentlich. Vielleicht lässt sich auch urteilen anhand von Ziel und Motivation. Doch immer besteht die Möglichkeit, dass auch ein Ingenieur mit bestem Willen handelt und trotzdem schuldig wird. Die Wirklichkeit des Bösen, die Erfahrung des Scheiterns und der Zerstörung von Beziehungen, ist genauso gegenwärtig wie bei Eva die Schlange. Vermutlich stand Adam neben Eva, und damit erhebt sich der Vorwurf: »Adam, warum warst du so still?« Sein Schweigen war verantwortungslos und verhängnisvoll, ebenso wie das vieler anderer Männer in entscheidenden Momenten der Weltgeschichte. Dazu ein Beispiel: Eine Frau namens Sarah sagt ihrem Mann: »Du, ich kann dir kein Kind gebären. Da du aber einen Erben brauchst, geh doch zu meiner Magd Hagar ein!« Darauf schweigt Abraham und tut es (1. Mose 16,2). Wer heute nach Nahost schaut, weiß, welche Folgen das Schweigen dieses Mannes hatte – die jahrtausendalte Fortsetzung des bitteren Bruderstreits zwischen Ismael und Isaak.
Seit dem Sündenfall lebt der Mensch mit der Erfahrung des Scheiterns und der (Ohn-) Macht des Zerstörerischen in seiner Hand. Er kann sich aus dieser verfahrenen Situation nicht selber herausziehen. Aber Gott hat Vorsorge getroffen, dass es weitergehen kann, was jedoch mit Schmerzen verbunden ist. Er legt dem Mann die Mühsal der Arbeit auf, den Schweiß, die Disteln und Dornen, und der Frau die Mühsal der Schwangerschaft und Geburt sowie den Versuch, den Mann zu kontrollieren (1. Mose 3,16), was entsprechende Beziehungsstörungen der Eheleute entstehen lässt. Auch bekleidet Gott das erste Menschenpaar mit Tierfellen, wofür einige unschuldige Tiere sterben mussten. Von daher will christliches Handeln kein romantisch verbrämtes Zurück in das Paradies und dieses mit menschlichen – gar technologischen – Mitteln erobern. Sondern der Christ weiß, dass der Weg in die Gemeinschaft mit Gott über einen sehr mühseligen und schmerzhaften Weg führt. Auch Gottes Wort an die Schlange drückt größten Schmerz aus: »Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen; er wird dir den Kopf zermalmen, und du wirst ihm die Ferse zermalmen.« (1. Mose 3,15). Diese göttliche Verfügung der Hoffnung auf eine Welt ohne den Bösen und das Böse ist letztlich durch das Sterben von Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Jetzt ist der Weg zur neuen Schöpfung frei. Christen wissen: Gott wird die heile Welt heraufführen. Jesus kündigt an: »Siehe, ich mache alles neu!« (Offenbarung 21,5).
Der Heilsbedürftige
Wir Menschen sind unfähig, eine heile Welt selbst zu realisieren, sondern sind darin vollständig auf Gott angewiesen. Wir stecken in großer Not und sind überaus heilsbedürftig. Darum können wir heilfroh sein, dass uns die frohe Botschaft eröffnet wird: Gott bietet Vergebung an. Wer zum Beispiel im beruflichen Umgang mit der Technik Fehler gemacht hat, kann darüber mit Gott sprechen. Gott gibt in seiner Liebe dem Erlösung suchenden Menschen Vergebung. Jedem, der es will, wird die Möglichkeit der Versöhnung zugesprochen. Wer diese annimmt, dem sichert Gott das Heil zu. Zwar soll nach gemachten Fehlern das Bestmögliche getan werden, um herauszukommen, aber Jesus Christus gibt das Einzige, was wirklich rettet. Er trägt nicht nur den Titel »Heiland« (d. i. »Retter«), sondern ist es wesenhaft. In ihm neigt sich Gottherzlich zu den Gefallenen herab. Das nennen wir »Erbarmen«, oder mit Martin Luther trefflich »Barmherzigkeit«.
An dem, der dieses Heilsangebot annimmt, arbeitet Gott heilsam und heiligend weiter. Ein Christ weiß, dass Gott sein gutes Werk in ihm angefangen hat und es auch vollenden wird (Philipper 1,6). Er weiß, dass Gott alles, was passiert, so verwendet, wie es »zum Guten mitwirkt« (Römer 8,28). Dieses Gute ist die Einprägung des Charakters Jesu im Christen, dergestalt, dass dieser dem Sohn Gottes »gleichförmig« wird. Einprägen ist mit Druck verbunden, ähnlich wie es des Druckes bedarf, wenn man auf einer Münze etwas einprägt. Wenn also Christen auch druckvolle Situationen erleben, ändert das nichts an der Sicherheit ihres Heils, sondern es soll ihr Wesen positiv, d. h. christusoffenbarend, verändern.
Die Ewigkeitsperspektive
Als Christ weiß ich also, wo ich ankommen werde. Wüsste ich dieses nicht, bliebe mir nichts übrig, als Technologie so einzusetzen, dass die Entwicklung irgendwie in Richtung Garten Eden zurückläuft. Dieser Weg zurück wurde aber vom Mensch verwirkt und von Gott versperrt. Wenn dieses begrenzte Erdenleben mein einziges Leben wäre, wäre es das einzige »Paradies«, das ich erleben würde. Es ist verständlich, wenn Menschen ohne Gott und Glauben in ihr Leben alles Mögliche hineinzustecken versuchen. Und so wachsen am stärksten eben die Vergnügungsanbieter und die Entertainment-Industrie. In diesen spielt Musik und Technologie eine große Rolle, um die seelische Leere der Gottesentfremdung irgendwie aufzufüllen. Das war ein beliebter Technologieeinsatz schon bei denen, die »vom Angesicht Gottes wegliefen« (s. 1. Mose 4,16.21.22). Auch heute finden Menschen ihre Idole (d. i. »Abgötter«) oft unter Musikern. Das Schöne beim Glauben an Jesus Christus ist also: In Heilssicherheit weiß ich, wohin es einmal gehen wird, und darum muss ich die Technik nicht dazu einsetzen, um mir ein ersehntes »Paradies« zu erringen. Denn der Glaube befreit von Sorge um mich selbst, so dass ich mich zukunftsorientiert dem Dienst für Gott und am Nächsten zuwenden kann. Auch so kann man einmal Technik beurteilen: Sie soll nicht mir dienen, sondern Verstärkungsfaktor sein, dass ich anderen besser dienen kann. Hat Jesus Christus im Gebot der Nächstenliebe nicht genau dieses verlangt?
Wenn der erlöste Mensch also Christus ähnlicher wird, geht er auch ethisch verantwortlicher mit den Dingen um. Denn Jesus Christus wäre mit unserer Technik nicht negativ umgegangen; in ihm will Gott uns ja den idealen Menschen zeigen. Wenn sich sein Wesen in uns ausprägt, wird auch unser Technikeinsatz christlicher. Und weil Gott die Zukunft eröffnet, erwartet der christliche Glaube die Vervollkommnung und damit auch den wirklich perfekten Technikeinsatz weder vom Menschen noch hier auf der Erde, sondern von Gott und in der von ihm geschaffenen Zukunft. Nun ist zwar jeder Ingenieur vom »Bazillus der Technik-Faszination« infiziert. Sonst würde keiner ein solches Studium beginnen. Trotzdem erwartet ein Ingenieur, der zuerst und vor allem Christ ist, das Vollkommene nur von Gott, nicht von Menschen, noch von Anwendungen der Technologie.
Christen wissen auch vom Leben nach dem Tod. Diese Glaubensaussage hilft zu verstehen, was menschliches Leben hier soll. »So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen!« (Psalm 90,12). Wenn ich mein Leben vom Ende her beurteile, also mit Ewigkeitsperspektive (die mir nur die Offenbarung Gottes in der Bibel geben kann), dann gibt es in manchen Dingen einen anderen Wert, als es Politik, Zeitgeist oder Werbung zu vermitteln suchen. Auch brauche ich dann nicht jede Modeströmung mitzumachen, jede aktuelle Mode ist morgen sowieso schon wieder veraltet.
Von daher unterscheiden Christen zwischen einem »Schon jetzt« und einem »Noch nicht«. Durch den Glauben an Christus leben sie in diesem Spannungsfeld. Von dieser Ewigkeitsperspektive her kann ich zum Beispiel Erfüllungsaufschub ertragen, dass ich jetzt nicht alles erfüllt bekomme, wie ich es mir vorstelle. Durch das Wissen um die zukünftige Herrlichkeit kann ich auch etwas erleiden. »Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen« (1. Petrus 5,10). Dieses Leiden kann bezüglich des Glaubens geschehen, aber auch einfach darin bestehen, dass ich wie alle Menschen den Ereignissen dieser Welt ausgesetzt bin, den Katastrophen und Unfällen, den Wettereinflüssen oder Ernährungsbedingungen.
Ebenso kann die Entwicklung der Gentechnik, nachdem jetzt das menschliche Genom entschlüsselt worden ist, weiteres Leiden nach sich ziehen. Auch Christen werden vielleicht unter kommenden Verhältnissen leiden müssen. Aber sie können es, weil sie wissen: Es gibt ein »Schon jetzt«. Darin besteht die Sinnerfüllung.
Allerdings können Christen auch gerade an der Sinnerfüllungsfrage leiden, wenn etwas misslingt. Das Wissen jedoch, was am Ende der Tage durch Gott kommen wird, trägt hindurch.
Dass Christen mit diesem Ewigkeitsblick und Erfüllungsaufschub leben können, daran ändert sich nichts, wenn viele dieses nur als Ideologie bezeichnen. Der Glaube wird allerdings auf Belastbarkeit erprobt, wenn diese Fähigkeit, Spannung zu ertragen, von »geschäftstüchtigen« Arbeitgebern zum Eigennutz missbraucht wird. Es kann vorkommen, dass solch einer beschließt: Diesen Christen gebe ich weniger Lohn und mute ihnen trotzdem mehr Überstunden zu.
Die christliche Grundnorm
Christen erwarten von der »Technik« lediglich, dass das Menschenmögliche getan wird. Dadurch ist der Blick geschärft für manche Vertröstungen der Welt, die im Grunde nur Ausreden für Passivität sind. Wenn Gottes Auftrag an Menschen lautet, in der Welt, in die uns Gott gesetzt hat, als Techniker, Ingenieur oder Architekt zu arbeiten, dann erkennen Gläubige ihre Verantwortung. Sie sollen sich nicht zurückziehen und alle technischen Neuerungen bekämpfen, sollen sich weder passiv hinter Klostermauern zurückziehen noch aktiv in die falsche Richtung, also falsche Ziele verfolgend, arbeiten.
Christen können sich für Passivität in der Welt nicht entschuldigen. Sie sind befähigt, mit dieser noch nicht endgültigen Wirklichkeit umzugehen und im Glauben aktiv zu arbeiten, auch technisch, und nicht angesichts des Scheitern-Könnens zu verzweifeln.
Doch welches ist die Norm? Was lehrte Jesus? Für was steht er? Seine Zeitgenossen haben das zu erforschen versucht. Verschiedene religiöse und politische Gruppen haben Beauftragte zu Jesus gesandt und ihm Fragen gestellt, vorrangig Fangfragen. Entscheidend war die Frage nach der Maxime: »Welche oberste Norm soll unser Handeln kennzeichnen?« Jesus antwortete darauf: »Das erste [Gebot] ist: ›Höre, Israel: Der Herr, unser Gott, ist ein Herr; und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft‹« (Markus 12,29f). Das Wort »Herz« bezeichnet das Zentrum der Persönlichkeit, von dem aus alles andere gesteuert wird: die intellektuelle Fähigkeit, den Willen, die Liebesfähigkeit u. a. Alle Lebensmodi (o. Fakultäten des Lebens) hängen von der Grundeinstellung des Herzens ab: Ist das Herz klar, sind es auch die daraus folgenden Handlungen. Jesus sagte: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen«, also nicht oberflächlich, nicht rituell, nicht aufgesetzt oder manchmal, sondern stets mit allem. Gott ist nie oberflächlich, er geht stets gezielt zur Schaltzentrale, hinunter zur Wurzel (also radikal), greift immersiv zum »Herzen« des Menschen.
Was hat das mit Technik zu tun? Das Gebot, Gott zu lieben, hat Jesus Christus oft wiederholt, und darum sollte es auch für Christen die oberste ethische Norm sein. Darauf folgt das zweite Gebot, das der Liebe zum Nächsten: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« (Markus 12,31a). In beiden Geboten ist laut Jesus Christus der ganze Dekalog, das, was Gott vom Menschen will, zusammengefasst. Ich bezeichne dies als »christliche Grundnorm«. Die Christen haben sich immer daran orientiert. Aus dem Gebot der Nächstenliebe lässt sich Weiteres ableiten, zum Beispiel, dass die Bedürftigkeit meines Nächsten vor meiner eigenen Vorrang hat. Welch ein Anspruch!
Darüber hinaus zeigt Jesu Gebot der Feindesliebe, dass dem anderen zumindest ein Recht zusteht, anders zu sein. Dieses kleine Stückchen Liebe, den anderen anders sein zu lassen, auch wenn er eine ganz andere Kultur in unsere Gesellschaft bringt, sollten Christen zeigen.
Was das im verantwortlichen Umgang mit Technik zu bedeuten hat, ist nicht schwer zu folgern. Denn zum Teil leben wir davon, dass wir anderen bestimmte Techniken vorenthalten, so in der Kriegstechnologie und der zivilen Technologie. Auch ist logisch, dass Reiche die besseren Technologien besitzen. Ist nicht im Wirtschaftlichen überall das Geld entscheidend? Wer viel Geld hat (oder erzeugen kann), bekommt alles, wer wenig hat, kriegt nichts. Ist das alles mit dem Liebesgebot in Übereinstimmung zu bringen? Nur wenige Christen haben Gegenzeichen im Bereich der Wirtschaft und Gesellschaft gesetzt, etwa durch Streben nach Gerechtigkeit und Wohltätigkeit. Manche Unternehmer versuchen, die Verantwortung, die ihre Angestellten tragen, zu honorieren und zu fördern, indem sie sie zu Mitunternehmern machen, sei es durch organisierte Mitsprache oder indirekt durch Kapitalbeteiligungen. Es gibt einige interessante Modelle, wie man diese Grundnormen in kreativer Art umsetzen kann, Mitarbeiter zu führen sowie Nutzen und Risiko miteinander zu tragen.
Zusammenfassung
Fassen wir unsere Betrachtung in Form einiger Leitaussagen zusammen, über die man ins Gespräch kommen sollte:
- Der Mensch wurde im Bild und Gleichnis Gottes erschaffen, hat mithin unveräußerliche Würde und Wert.
- Der Mensch ist Mitmensch. Er darf mit jemandem in Beziehung treten, der genauso ein Recht auf Fehler und Schwachheiten wie er selbst hat. Er ist mit Begabungen, demselben Wert, aber auch mit denselben Schwachheiten versehen, er ist Sünder.
- Der Mensch ist Teilhaber. Er muss darauf achten, dass die Teilhabe gerecht geschieht.
- Christen können unterscheiden zwischen dem, was jetzt möglich ist, und dem, was erst unter der Herrschaft Jesu Christi möglich sein wird. Sie dürfen nicht das Recht des Relativen verachten, indem sie denen Schwierigkeiten machen, die keine perfekten Lösungen erreichen.
- Christen akzeptieren, dass es verschiedene berechtigte Ansprüche gibt, dass manche ihr Leben eben anders leben, auch als Ingenieure. Christliche Technik fragt danach, was moralisch vertretbar ist oder nicht.
- Dabei bindet sich der Christ an Gottes Wort, an die Lehre Jesu Christi. Dieser hat sich in verschiedenen Fragen der Lebensführung immer auf die Genesis bezogen. Er geht also immer auf die Ursprünge zurück, wo er als Schöpfer gehandelt hat.
- Somit und letztlich ist Jesus das immer verpflichtende Vorbild für christliche Ethik, auch und gerade im Erschaffen, Gestalten, Einsetzen und Nutzen von Technik.
Christliche Technik – Gibt es so etwas?
Nein, an sich nicht. Schon eher von einer »christlichen Technikfolgenabschätzung«, einer Bewertung von Technik anhand christlicher Werte, Maximen und Normen. Es ist zu beurteilen, welche Werte und Ziele beim Erschaffen und Betreiben gesetzt werden und wirksam sind. Von »christlicher« Technik kann man nur reden, wenn sie wertverträglich mit christlichen Werten ist. Dazu bedarf es der Ausrichtung an dem, was Jesus Christus gesagt hat und in der Bibel schriftlich aufzeichnen ließ. Das wird auch den Blick für den Unterschied zwischen dem, was ist, und dem, was noch nicht ist, schärfen und die Geduld mit dem Unvollkommenen im anderen und in mir selbst fördern. Gelebtes Christsein macht genügsam beim Entzug und im Verzicht und geduldig im Leiden.
Jesus fordert im Blick auf die Ewigkeit auf: »Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß gibt, so reiß es aus und wirf es von dir…« (Matthäus 5,29). Er rät in dieser Bildsprache also zu entschiedener Vorgehensweise: Weg mit dem, das dich auf deinem Weg zur Ewigkeit, zu Gott hin, hindert, selbst wenn es ein geliebter, faszinierender Technikeinsatz ist! Technik hingegen mit Ewigkeitsperspektive einzusetzen, mag an ein gutes Ziel führen. Ein Ingenieur oder Techniker, der Christ ist, muss sich immer fragen, ob er einmal vor Jesus stehend ähnlich dem Knecht des bekannten Gleichnisses (vgl. Matthäus 25,14–30; Lukas 19,16–27) sagen kann: »Herr, ich habe gehandelt, auch unter verstärkendem Einsatz der Technik, um das, was ich von dir bekommen habe, zu vermehren.« Er muss fragen, ob dann Jesus wohl antworten wird: »Wohl, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen; geh ein in die Freude deines Herrn!« und den Betreffenden dann in größere Verantwortung setzt. Die hier genannten Leitlinien können eine praktische Hilfe für die Realisierung verantwortlicher, »christlicher Technik« sein.
[1] Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Uwe A. Seidel beim DCTB-Regionaltreffen in Böblingen am 17.3.2001. Verkürzte Wiedergabe (s. Das Fundamentum, Nr. 5/2001, DCTB e.V.), Überarbeitung vom Vortragenden autorisiert. – Angesichts der Entwicklungen der letzten beiden Jahrzehnte (Big Data, automatisierte Überwachung und Predictive Profiling, AI, Transhumanismus, Homo deus etc. nebst Zivilreligion, Carbonkult u.a.) erweisen sich die hier skizzierten Überlegungen weiter als äußerst relevant.
[2] o. V.: Technikbewertung – Begriffe und Grundlage (Technology assessment – Concepts and foundation), VDI 3780. Erscheinungsdatum 2000-09.