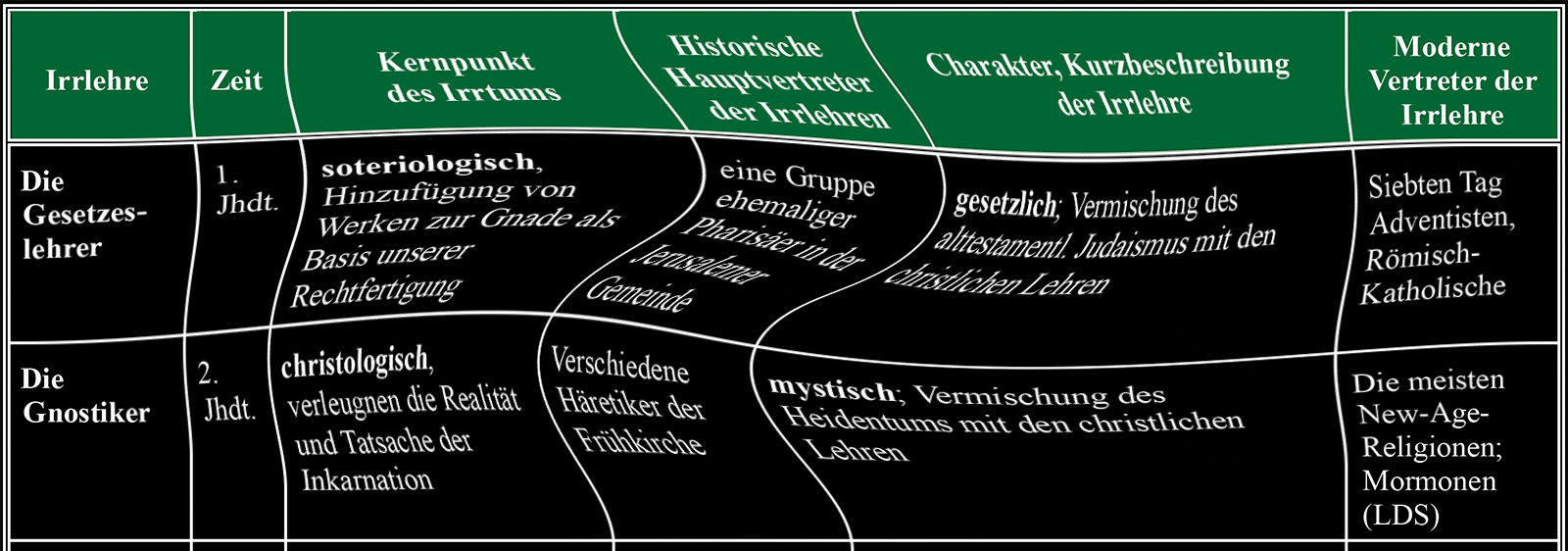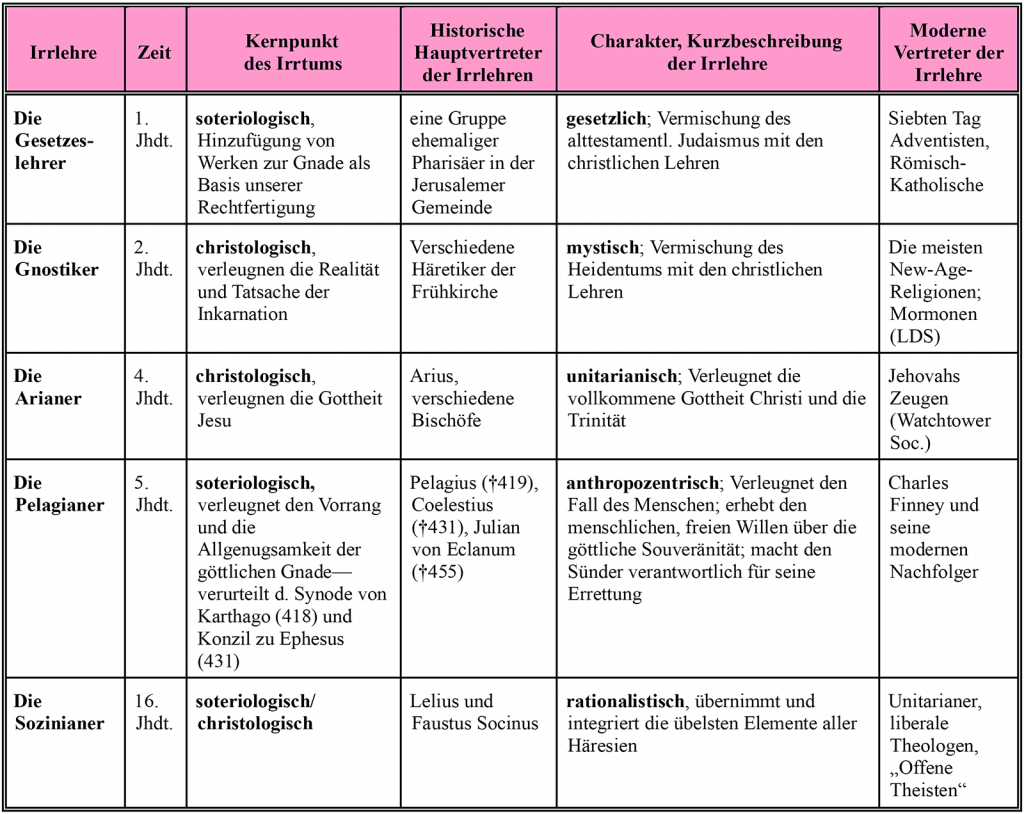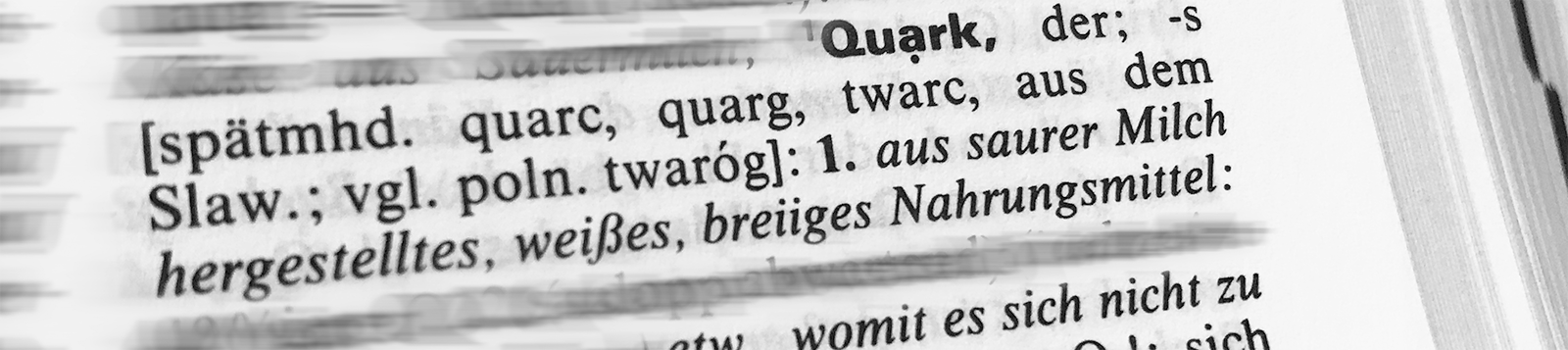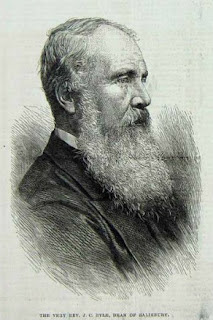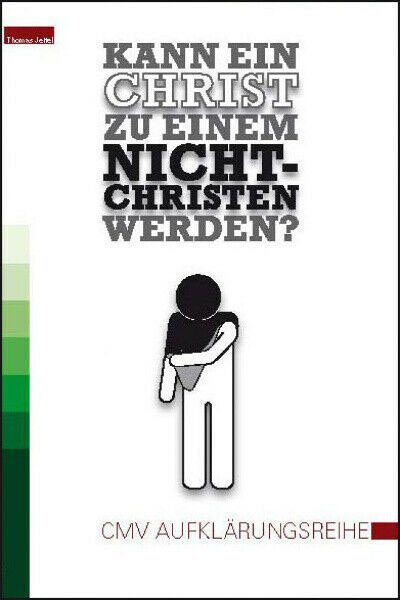Kurz nach Beginn der Reformation, in den ersten Jahren nachdem Martin Luther die 95 Thesen an die Kirchentür in Wittenberg angeschlagen hatte, veröffentlichte er einige kurze Broschüren zu verschiedenen Themen. Eine der provokantesten trug den Titel »Die babylonische Gefangenschaft der Kirche«. In diesem Buch blickte Luther auf jene Zeit in der Geschichte des Alten Testaments zurück, als Jerusalem von den einfallenden babylonischen Armeen zerstört und die Elite des Volkes in die Gefangenschaft verschleppt wurde. Luther übertrug im 16. Jahrhundert das Bild der historischen babylonischen Gefangenschaft auf seine Zeit und sprach von der neuen babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Er bezeichnete Rom (die Römisch-katholische Kirche) als das moderne Babylon, das das Evangelium als Geisel hielt, indem es das biblische Verständnis der Rechtfertigung ablehnte. Man kann sich vorstellen, wie heftig die Kontroverse war und wie polemisch dieser Titel in dieser Zeit war, wenn man sagt, dass die Kirche nicht einfach nur geirrt oder vom Weg abgekommen sei, sondern gefallen sei – dass sie jetzt tatsächlich babylonisch sei, dass sie jetzt in heidnischer Gefangenschaft sei.
Ich habe mich oft gefragt, was Luther wohl sagen würde, wenn er heute leben und in unsere Kultur kommen würde und sich nicht die liberale Kirchengemeinschaften, sondern die evangelikalen Kirchen ansehen würde. Natürlich kann ich diese Frage nicht mit endgültiger Autorität beantworten, aber ich vermute Folgendes: Wenn Martin Luther heute leben und seinen Stift zur Hand nehmen würde, um zu schreiben, würde das Buch, das er in unserer Zeit schreiben würde, den Titel Die pelagische Gefangenschaft der evangelikalen Kirche tragen. Luther sah, dass die Rechtfertigungslehre durch ein viel tieferes theologisches Problem angegriffen wurde. Er schreibt ausführlich darüber in Von der Freiheit eines Christenmenschen. Wenn wir uns die Reformation ansehen und die Soli der Reformation betrachten – sola scriptura • sola fide • sola gratia • solus Christus • soli Deo gloria – war Luther davon überzeugt, dass das eigentliche Thema der Reformation die Frage der Gnade war; und dass der Lehre von sola fide, der Rechtfertigung durch den Glauben allein, die vorherige Verpflichtung zu sola gratia, dem Konzept der Rechtfertigung durch Gnade allein, zugrunde lag.
In der Fleming-Revell-Ausgabe von »The Bondage of the Will« [orig.: De Servo Arbitrio; dtsch.: Vom unfreien Willen, oder: Über den geknechteten Willen, 1525] fügten die Übersetzer J. I. Packer und O. R. Johnston eine etwas provokative historische und theologische Einführung in das Buch selbst ein. So lautet der Schluss dieser Einführung:
Über diese Dinge müssen Protestanten heute nachdenken. Mit welchem Recht können wir uns Kinder der Reformation nennen? Vieles im modernen Protestantismus würde von den Reformatoren der ersten Stunde weder anerkannt noch gutgeheißen werden. Das Buch Vom unfreien Willen zeigt uns ziemlich genau, was sie über die Erlösung der verlorenen Menschheit glaubten.
Im Lichte dessen sind wir gezwungen zu fragen, ob das protestantische Christentum zwischen Luthers Zeit und unserer Zeit nicht auf tragische Weise sein Geburtsrecht verkauft hat. Ist der Protestantismus heute nicht eher erasmisch als lutherisch geworden? Versuchen wir nicht zu oft, Lehrunterschiede zu minimieren und zu beschönigen, um des Friedens zwischen den Parteien willen? Sind wir unschuldig, was die Gleichgültigkeit gegenüber der Lehre, die Luther Erasmus vorwarf, angeht? Glauben wir immer noch, dass die biblische Lehre wichtig ist? [1]
Historisch gesehen ist es eine einfache Tatsache, dass Luther, Calvin, Zwingli und alle führenden protestantischen Theologen der ersten Epoche der Reformation hier genau auf dem gleichen Standpunkt standen. In anderen Punkten hatten sie ihre Differenzen. Sie waren sich jedoch völlig einig, was die Hilflosigkeit des Menschen in der Sünde und die Souveränität Gottes in der Gnade betraf. Für jeden von ihnen waren diese Lehren das Herzblut des christlichen Glaubens. Ein moderner Herausgeber von Luthers Werken sagt dazu:
Wer dieses Buch aus der Hand legt, ohne erkannt zu haben, dass die evangelische Theologie mit der Lehre von der Unfreiheit des Willens steht oder fällt, hat es vergeblich gelesen. Die Lehre von der freien Rechtfertigung allein durch den Glauben, die während der Reformationszeit zum Zentrum so vieler Kontroversen wurde, wird oft als das Herzstück der Theologie der Reformatoren angesehen, aber das ist nicht richtig. Die Wahrheit ist, dass ihr Denken sich wirklich auf die Behauptung des Paulus konzentrierte, die von Augustinus und anderen aufgegriffen wurde, dass die gesamte Erlösung des Sünders nur durch freie und souveräne Gnade geschieht, und dass die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben für sie wichtig war, weil sie das Prinzip der souveränen Gnade sicherte. Diese Souveränität der Gnade fand in ihrem Denken auf einer noch tieferen Ebene in der Lehre von der monergistischen [allein von Gott gewirkten] Wiedergeburt Ausdruck. [2]
Das heißt, dass der Glaube, der Christus zur Rechtfertigung annimmt, selbst das freie Geschenk eines souveränen Gottes ist. Das Prinzip des sola fide wird erst dann richtig verstanden, wenn es als im umfassenderen Prinzip des sola gratia verankert betrachtet wird. Was ist die Quelle des Glaubens? Ist es das von Gott gegebene Mittel, durch das die von Gott gegebene Rechtfertigung empfangen wird, oder ist es eine Bedingung der Rechtfertigung, die der Mensch erfüllen muss? Hören Sie den Unterschied? Ich möchte es in einfachen Worten ausdrücken. Ich hörte kürzlich einen Evangelisten sagen: »Wenn Gott tausend Schritte unternimmt, um dich für deine Erlösung zu erreichen, musst du letztendlich immer noch den entscheidenden Schritt tun, um gerettet zu werden.« Denken Sie an die Aussage von Amerikas beliebtestem und führendem Evangelisten des 20. Jahrhunderts, Billy Graham, der mit großer Leidenschaft sagte: »Gott erledigt neunundneunzig Prozent, aber du musst immer noch das letzte Prozent tun.«
Was ist Pelagianismus?
Kommen wir nun kurz auf meinen Titel »Die pelagianische Gefangenschaft der Kirche« zurück. Worüber sprechen wir? Pelagius war ein Mönch, der im fünften Jahrhundert in Großbritannien lebte (um 350–420). Er war ein Zeitgenosse des größten Theologen des ersten Jahrtausends der Kirchengeschichte, wenn nicht aller Zeiten, Aurelius Augustinus (354–430), Bischof von Hippo in Nordafrika. Wir haben vom heiligen Augustinus gehört, von seinen großen theologischen Werken, von seinem »Gottesstaat« (De civitate Dei contra Paganos), von seinen »Bekenntnissen« (Confessiones) und so weiter, die nach wie vor zu den Klassikern der christlichen Literatur gehören.
Augustinus war nicht nur ein herausragender Theologe und ein erstaunlicher Intellektueller, sondern auch ein Mann von tiefer Spiritualität und Gebet. In einem seiner berühmten Gebete machte Augustinus eine scheinbar harmlose und unschuldige Aussage in dem Gebet zu Gott, in dem er sagte: »O Gott, befehle, was du willst, und gewähre, was du befiehlst.« Nun, würde Sie es in Rage versetzen, wenn Sie ein solches Gebet hörten? Jedenfalls versetzte es Pelagius, diesen britischen Mönch, ordentlich in Aufruhr. Er protestierte lautstark und appellierte sogar an Rom, dieses grässliche Gebet aus der Feder des Augustinus zu verbannen. Was war der Grund seiner Empörtheit? Er sagte: »Willst du damit sagen, Augustinus, dass Gott das angeborene Recht hat, seinen Geschöpfen alles zu befehlen, was er will? Niemand wird das bestreiten. Gott hat als Schöpfer von Himmel und Erde von Natur aus das Recht, seinen Geschöpfen Verpflichtungen aufzuerlegen und zu sagen: ‚Du sollst dies tun und du sollst das nicht tun.‘ ‚Befiehl, was du willst‘ – das ist ein vollkommen legitimes Gebet.«
Es ist der zweite Teil des Gebets, den Pelagius verabscheute, als Augustinus sagte: »und gewähre, was du befiehlst.« Er sagte: »Wovon redest du? Wenn Gott gerecht ist, wenn Gott rechtschaffen ist und Gott heilig ist und wenn Gott dem Geschöpf befiehlt, etwas zu tun, dann muss dieses Geschöpf sicherlich die Kraft in sich haben, die moralische Fähigkeit in sich haben, es auszuführen, sonst würde Gott es gar nicht erst verlangen.« Klingt logisch, oder? Pelagius wollte damit sagen, dass moralische Verantwortung immer und überall moralische Fähigkeit oder einfach moralische Befähigung impliziert. Warum sollten wir also beten müssen: »Gott, gib mir die Gabe, das zu tun, was du mir befiehlst«? Pelagius sah in dieser Aussage einen Schatten, der auf die Integrität Gottes selbst geworfen wurde, der die Menschen für etwas verantwortlich machen würde, das sie nicht tun können.
In der anschließenden Debatte machte Augustinus deutlich, dass Gott Adam und Eva bei der Schöpfung nichts befohlen hatte, was sie nicht hätten ausführen können. Aber als die Sünde Einzug hielt und die Menschheit fiel, wurde Gottes Gesetz nicht aufgehoben, noch passte Gott seine heiligen Anforderungen nach unten an, um dem geschwächten, gefallenen Zustand seiner Schöpfung Rechnung zu tragen. Gott bestrafte seine Schöpfung, indem er das Urteil der Erbsünde über sie verhängte, sodass jeder, der nach Adam und Eva in diese Welt geboren wurde, bereits tot in Sünde geboren wurde. Die Erbsünde ist nicht die erste Sünder, sie ist das Ergebnis der ersten Sünde. Sie bezieht sich auf unsere angeborene Verderbtheit, durch die wir in Sünde geboren werden: in Sünde haben uns unsere Mütter empfangen. Wir werden nicht in einem neutralen Zustand der Unschuld geboren, sondern in einem sündigen, gefallenen Zustand. Praktisch jede Kirche im historischen Ökumenischen Rat der Kirchen artikulierte zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Geschichte und in ihrer Bekenntnisentwicklung eine Lehre von der Erbsünde. Denn diese geht so klar aus der biblischen Offenbarung hervor, dass es einer Ablehnung der biblischen Sichtweise vom Menschen bedürfte, um die Erbsünde gänzlich zu leugnen.
Genau darum ging es im Streit zwischen Augustinus und Pelagius im fünften Jahrhundert. Pelagius sagte, dass es so etwas wie Erbsünde nicht gebe. Adams Sünde beträfe Adam, und nur Adam. Es gebe keine Übertragung oder Weitergabe von Schuld, Sündenfall oder Verderbtheit an die Nachkommen Adams und Evas. Jeder Mensch werde in demselben Zustand der Unschuld geboren, in dem Adam erschaffen wurde. Pelagius sagte, dass es für einen Menschen durchaus möglich sei, ein Leben im Gehorsam gegenüber Gott, ein Leben in moralischer Vollkommenheit, zu führen, ohne irgendeine Hilfe von Jesus oder irgendeine Hilfe durch die Gnade Gottes dafür zu benötigen. Pelagius sagte damit, dass die Gnade – und hier liegt der entscheidende Unterschied – die Gerechtigkeit erleichtert.
Was bedeutet aber in diesem Zusammenhang »erleichtern«? Die Gnade hilft, macht es einfacher, macht es leichter. Aber man muss diese Gnade nicht haben, man kann auch ohne Gnade vollkommen sein. Pelagius erklärte weiter, dass es für manche Menschen nicht nur theoretisch möglich sei, ein vollkommenes Leben ohne jegliche Hilfe durch göttliche Gnade zu führen, sondern dass es tatsächlich Menschen gebe, die dies tun. Augustinus reagierte darauf mit einem: »Nein, nein, nein, nein … wir sind von Natur aus bis in die Tiefen und den Kern unseres Seins von der Sünde infiziert – so sehr, dass kein Mensch die moralische Kraft hat, sich der Gnade Gottes zuzuwenden.« Der menschliche Wille hat aufgrund der Erbsünde zwar immer noch die Macht zu wählen, ist aber seinen bösen Wünschen und Neigungen verfallen. Der Zustand der gefallenen Menschheit ist einer, den Augustinus als die Unfähigkeit, nicht zu sündigen, beschreiben würde. Einfach gefasst sagte Augustinus damit, dass der Mensch durch den Sündenfall die moralische Fähigkeit verloren habe, das zu tun, was Gott will, und dass er von seinen eigenen bösen Neigungen gefangen gehalten werde.
Im fünften Jahrhundert verurteilte die Kirche Pelagius als Ketzer. Der Pelagianismus wurde auf dem Konzil von Orange (529, ehemals Arausio genannt, in Südfrankreich) verurteilt und erneut auf dem Konzil von Florenz (1437–1447), dem Konzil von Karthago (418) und ironischerweise auch auf dem Konzil von Trient (1545–1563) im 16. Jahrhundert in den ersten drei Anathemas der Kanones der sechsten Sitzung. Die Kirche hat also den Pelagianismus durchweg in der gesamten Kirchengeschichte rundheraus und entschieden verurteilt – weil der Pelagianismus die Gefallenheit unserer Natur leugnet; er leugnet die Lehre von der Erbsünde.
Nun war das, was man als Semi-Pelagianismus bezeichnet, wie das Präfix „semi“ andeutet, eine Art Mittelweg zwischen dem voll ausgebildeten Augustinianismus und dem voll ausgebildeten Pelagianismus. Der Semi-Pelagianismus besagt Folgendes: Ja, es gab einen Sündenfall; ja, es gibt so etwas wie Erbsünde; ja, die grundlegende Natur des Menschen wurde durch diesen Zustand der Verderbtheit verändert und alle Teile unserer Menschlichkeit wurden durch den Sündenfall erheblich geschwächt, so sehr, dass ohne die Hilfe der göttlichen Gnade niemand erlöst werden kann, sodass die Gnade nicht nur hilfreich, sondern für die Erlösung absolut notwendig ist. Wir sind zwar so tief gesunken, dass wir ohne Gnade nicht gerettet werden können, aber wir sind nicht so tief gesunken, dass wir nicht die Fähigkeit hätten, die Gnade anzunehmen oder abzulehnen, wenn sie uns angeboten wird. Der Wille ist geschwächt, aber nicht versklavt. Im Kern unseres Wesens gibt es eine Insel der Rechtschaffenheit, die vom Sündenfall unberührt bleibt. Ausgehend von dieser kleinen Insel der Rechtschaffenheit, diesem kleinen Stückchen Güte, das in der Seele oder im Willen noch intakt ist, liegt der entscheidende Unterschied zwischen Himmel und Hölle. Es ist diese kleine Insel, die genutzt werden muss, wenn Gott seine tausend Schritte unternimmt, um uns zu erreichen, aber letztendlich ist es der eine Schritt, den wir tun, der darüber entscheidet, ob wir in den Himmel oder in die Hölle kommen – ob wir diese kleine Gerechtigkeit, die im Kern unseres Wesens liegt, ausüben oder nicht. Diese kleine Insel würde Augustinus nicht einmal als Atoll im Südpazifik erkennen. Er sagte, es sei eine Insel der Phantasie (wörtlich.: »mythische Insel«), vielmehr sei der Wille versklavt und der Mensch tot in seinen Sünden und Verfehlungen.
Ironischerweise verurteilte die Kirche den Semi-Pelagianismus genauso vehement, wie den ursprünglichen Pelagianismus. Doch als man im 16. Jahrhundert das katholische Verständnis dessen las, was bei der Erlösung geschieht, wies die Kirche im Grunde genommen das zurück, was Augustinus und auch Aquin gelehrt hatten. Die Kirche kam zu dem Schluss, dass es immer noch diese Freiheit gebe, dass etwas im menschlichen Willen noch intakt sei, und dass der Mensch mit der »vorauslaufenden« Gnade, die Gott ihm anbietet, kooperieren und ihr zustimmen müsse (und könne). Wenn wir diesen Willen ausüben, wenn wir mit den Kräften, die uns noch bleiben, kooperieren, werden wir gerettet. Und so kehrte die Kirche im 16. Jahrhundert zum Semi-Pelagianismus zurück.
Zur Zeit der Reformation waren sich alle Reformatoren in einem Punkt einig: dass der gefallene Mensch unfähig sei, sich den Dingen Gottes zuzuwenden; dass alle Menschen, um gerettet zu werden, völlig, nicht zu neunundneunzig Prozent, sondern zu hundert Prozent von der monergistischen Arbeit der Erneuerung abhängig seien, um zum Glauben zu gelangen, und dass der (rettende) Glaube selbst ein Geschenk Gottes sei. Es ist nicht so, dass uns die Erlösung angeboten wird und wir wiedergeboren werden, wenn wir uns für den Glauben entscheiden. Wir können vielmehr nicht einmal (rettend) glauben, bis Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit zuerst die Neigungen unserer Seelen durch sein souveränes Werk der Erneuerung verändert. Mit anderen Worten: Die Reformatoren waren sich alle einig, dass ein Mensch, der nicht wiedergeboren ist, das Reich Gottes nicht einmal sehen kann, geschweige denn in es eintreten kann (Johannes 3,3.5). Wie Jesus im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums sagt: »Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht« (6,44). Die notwendige Bedingung für den Glauben und die Erlösung eines jeden Menschen ist seine Erneuerung durch »Geburt von oben«.
Evangelikale und Glaube
Der moderne Evangelikalismus lehrt fast einheitlich und allgemein, dass ein Mensch, um wiedergeboren zu werden, zuerst Glauben ausüben muss. Man muss sich dafür entscheiden, wiedergeboren zu werden. Ist es nicht das, was Sie hören? In einer Umfrage von George Barna[3] äußerten mehr als siebzig Prozent der »bekennenden evangelikalen Christen« in Amerika die Überzeugung, dass der Mensch im Grunde gut ist. Und mehr als achtzig Prozent vertraten die Ansicht, dass Gott denen hilft, die sich selbst helfen. Diese Positionen – oder lassen Sie es mich negativ ausdrücken – keine dieser Positionen ist semi-pelagianisch. Sie sind beide pelagianisch. Zu sagen, dass wir im Grunde gut sind, ist die pelagianische Ansicht. Ich würde davon ausgehen, dass in mindestens dreißig Prozent der Menschen, die diesen Artikel lesen, und wahrscheinlich mehr, wenn wir ihr Denken wirklich eingehend untersuchen, wir Herzen finden würden, die für den Pelagianismus schlagen. Wir sind davon überwältigt. Wir sind davon umgeben. Wir sind darin versunken. Wir hören es jeden Tag. Wir hören es jeden Tag in der säkularen Kultur. Und wir hören es nicht nur jeden Tag in der säkularen Kultur, sondern auch jeden Tag im christlichen Fernsehen und im christlichen Radio.
Im 19. Jahrhundert gab es einen Prediger, der in Amerika sehr populär wurde und ein Buch über Theologie schrieb, das aus seiner eigenen juristischen Ausbildung hervorging und in dem er keinen Hehl aus seinem Pelagianismus machte. Er lehnte nicht nur den Augustinianismus ab, sondern auch den Semi-Pelagianismus, und bezog klar Stellung zum vollen Pelagianismus, indem er ohne Umschweife und ohne jegliche Zweideutigkeit sagte, dass es keinen Sündenfall gab und dass es so etwas wie Erbsünde nicht gebe. Dieser Mann griff die Lehre von der stellvertretenden Sühne Christi heftig an und lehnte darüber hinaus die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben allein durch die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi so laut und deutlich wie möglich ab. Die Grundthese dieses Mannes lautete: Wir brauchen die Zurechnung der Gerechtigkeit Christi nicht, weil wir aus uns selbst heraus die Fähigkeit haben, gerecht zu werden. Sein Name ist Charles Finney, einer der am meisten verehrten Evangelisten Amerikas [4]. Wenn Luther nun Recht hatte mit seiner Aussage, dass »sola fide« der Artikel ist, auf dem die Kirche steht oder fällt, und wenn die Reformatoren sagten, dass die Rechtfertigung durch den Glauben allein eine wesentliche Wahrheit des Christentums ist, die auch argumentierten, dass die stellvertretende Sühne eine wesentliche Wahrheit des Christentums ist; wenn sie mit ihrer Einschätzung, dass diese Lehren wesentliche Wahrheiten des Christentums sind, Recht haben, dann können wir nur zu dem Schluss kommen, dass Charles Finney kein Christ war. Ich habe seine Schriften gelesen und sage: »Ich verstehe nicht, wie ein Christ so etwas schreiben kann.« Und doch ist er in der Ruhmeshalle des evangelikalen Christentums in Amerika. Er ist der Schutzpatron des Evangelikalismus des 20. Jahrhunderts. Und er ist kein Semi-Pelagianer; er vertrat vielmehr ungeschminkt den Pelagianismus.
Die Insel der Rechtschaffenen
Eines ist klar: Man kann rein pelagianisch und trotzdem in der heutigen evangelikalen Bewegung vollkommen willkommen sein. Es ist nicht einfach so, dass das Kamel seine Nase in das Zelt steckt; es kommt nicht nur in das Zelt – es wirft den Besitzer des Zeltes hinaus. Der moderne Evangelikalismus betrachtet die reformierte Theologie, die zu einer Art drittklassigem Bürger des Evangelikalismus geworden ist, heute mit Argwohn. Jetzt sagen Sie: »Moment mal, R. C.! Wir sollten nicht alle mit dem extremen Pelagianismus in einen Topf werfen, denn schließlich sagen Billy Graham und der Rest dieser Leute, dass es einen Sündenfall gab, dass man Gnade braucht, dass es so etwas wie Erbsünde gibt und dass Semi-Pelagianer nicht mit Pelagius‘ oberflächlicher und zuversichtlicher Sichtweise der ungefallenen menschlichen Natur übereinstimmen.« Und das ist wahr, keine Frage. Aber es ist diese Behauptung von einer kleinen Insel der Rechtschaffenheit, auf der der Mensch immer noch die Fähigkeit habe, aus sich selbst heraus sich zu bekehren, zu ändern, sich zu neigen, zu entscheiden, das Angebot der Gnade anzunehmen, das offenbart, warum der Semi-Pelagianismus historisch gesehen nicht Semi-Augustinianismus, sondern Semi-Pelagianismus genannt wird.
Ich habe gehört, wie ein Evangelist zwei Analogien verwendete, um zu beschreiben, was bei unserer Erlösung geschehe. (1) Er sagte, dass die Sünde uns so stark im Würgegriff habe, dass es wie bei einer Person sei, die nicht schwimmen kann und in einem tobenden Meer über Bord gehe. Sie gehe zum dritten Mal unter und nur noch die Fingerspitzen seien über dem Wasser zu sehen. Wenn niemand eingreift, um sie zu retten, habe sie keine Überlebenschance, ihr Tod sei gewiss. Und wenn Gott dieser Person keinen Rettungsring zuwerfe, könne sie unmöglich gerettet werden. Und Gott müsse ihm nicht nur einen Rettungsring in die ungefähre Richtung zuwerfen, in der er sich befindet, sondern dieser Rettungsring müsse ihn genau dort treffen, wo seine Finger noch aus dem Wasser ragten, und ihn so treffen, dass er ihn greifen könne. Er müsse also perfekt geworfen werden. Aber dennoch würde diese Person ertrinken, es sei denn, sie nehme ihre Finger und schließe sie um den Rettungsring. So rette Gott sie. Wenn aber diese winzige menschliche Handlung nicht ausgeführt würde, werde sie mit Sicherheit zugrunde gehen.
(2) Die andere Analogie ist folgende: Ein Mann sei todkrank und liege mit seiner tödlichen Krankheit in seinem Krankenhausbett. Es gebe keine Möglichkeit, ihn zu heilen, es sei denn, jemand von außerhalb käme mit einem Heilmittel, einem Medikament, das diese tödliche Krankheit heilen könne. Und Gott habe dieses Heilmittel und käme in das Krankenzimmer mit diesem rettenden Medikament. Aber der Mann sei so schwach, dass er sich nicht einmal selbst das Medikament geben könne, Gott müsse es selbst auf einen Löffel gießen. Der Mann sei aber so krank, dass er fast im Koma liege. Er könne nicht einmal den Mund öffnen, Gott müsse sich vorbeugen und seinen Mund für ihn öffnen. Gott müsse den Löffel an die Lippen des Mannes bringen. Aber der Mann müsse die Medizin trotzdem schlucken.
Wenn wir schon Analogien verwenden, dann sollten wir auch (biblisch) genau sein. Der Mann geht nicht zum dritten Mal unter, vielmehr liegt er in Leichenstarre tot auf dem Meeresgrund. Dort wart ihr einst, als ihr tot wart in Sünden und Vergehen und dem Lauf dieser Welt gefolgt seid, dem Fürsten der Macht der Luft [vgl. Epheser 2,1–3]. Und Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht, als ihr tot wart [vgl. Epheser 2,4–8]. Gott tauchte auf den Meeresgrund und nahm diesen ertrunkenen Leichnam und hauchte ihm den Atem seines Lebens ein und erweckte ihn von den Toten. Und es ist nicht so, dass wir in einem Krankenhausbett an einer bestimmten Krankheit gestorben wären, sondern vielmehr, dass wir bei unserer Geburt tot auf die Welt kamen. Die Bibel sagt, dass wir moralisch tot geboren werden.
Haben wir einen Willen? Ja, natürlich haben wir einen Willen. Calvin sagte, wenn man unter einem freien Willen eine Entscheidungsfähigkeit versteht, durch die man die Macht in sich hat, das zu wählen, was man sich wünscht, dann haben wir alle einen freien Willen. Wenn man unter einem freien Willen die Fähigkeit gefallener Menschen versteht, sich zu beugen und diesen Willen auszuüben, um die Dinge Gottes zu wählen, ohne das vorherige monergistische Werk der Erneuerung, dann, so Calvin, ist der freie Wille ein viel zu großartiger Begriff, um ihn auf einen Menschen anzuwenden.
Die semi-pelagianische Doktrin des freien Willens, die heute in der evangelikalen Welt vorherrscht, ist eine heidnische Sichtweise, die die Gefangenschaft des menschlichen Herzens in der Sünde leugnet. Sie unterschätzt den Würgegriff, den die Sünde auf uns ausübt.
Keiner von uns möchte die Dinge so schlecht sehen, wie sie wirklich sind. Die biblische Lehre von der menschlichen Verderbtheit ist düster. Wir hören den Apostel Paulus nicht sagen: »Wisst ihr, es ist traurig, dass es so etwas wie Sünde in der Welt gibt; niemand ist perfekt. Aber seid guten Mutes. Wir sind im Grunde gut.« Sehen Sie, dass selbst eine oberflächliche Lektüre der Heiligen Schrift dies leugnet?
Nun zurück zu Luther. Was ist die Quelle und der Status des Glaubens? Ist er das von Gott gegebene Mittel, durch das die von Gott gegebene Rechtfertigung empfangen wird? Oder ist er eine Bedingung der Rechtfertigung, die wir erfüllen müssen? Ist Ihr Glaube ein Werk? Ist es das eine Werk, das Gott Ihnen zu tun überlässt? Ich hatte kürzlich eine Diskussion mit einigen Leuten in Grand Rapids, Michigan. Ich sprach über sola gratia, und ein Mann war verärgert.
Er sagte: »Wollen Sie mir sagen, dass es letztendlich Gott ist, der ein Herz souverän erneuert oder nicht?«
Und ich sagte: »Ja!«, und das hat ihn sehr verärgert. Ich sagte: »Lassen Sie mich Folgendes fragen: Sind Sie Christ?«
Er sagte: »Ja.«
Ich sagte: »Haben Sie Freunde, die keine Christen sind?«
Er sagte: »Nun, natürlich.«
Ich sagte: »Warum sind Sie Christ und Ihre Freunde nicht? Ist es, weil Sie rechtschaffener sind als sie?« Er war nicht dumm, darum sagte er nun nicht: »Natürlich, weil ich rechtschaffener bin. Ich habe das Richtige getan und mein Freund nicht.« Er wusste, worauf ich mit dieser Frage hinauswollte.
So sagte er: »Oh nein, nein, nein.«
Ich sagte: »Sagen Sie mir, warum. Ist es, weil Sie klüger sind, als Ihr Freund?«
Er antwortete: »Nein.«
Aber er wollte nicht zugeben, dass der entscheidende Punkt die Gnade Gottes war. Er wollte nicht darauf eingehen. Und nachdem wir fünfzehn Minuten lang darüber diskutiert hatten, sagte er: »Okay! Ich sage es: Ich bin Christ, weil ich das Richtige getan habe, ich habe die richtige Antwort gegeben, und mein Freund nicht«
Worauf vertraute diese Person für ihre Erlösung? Nicht auf ihre Werke im Allgemeinen, sondern auf das eine Werk, das sie vollbracht hatte. Und er war Protestant, ein Evangelikaler. Aber seine Ansicht über die Erlösung unterschied sich nicht von der römisch-katholischen Ansicht.
Gottes Souveränität in der Erlösung
Es geht im Kern um Folgendes: Was entscheidet letztlich das Heil? Ist es Teil von Gottes Geschenk der Erlösung oder ist es unser eigener Beitrag zur Erlösung? Ist unsere Erlösung ganz und gar Gottes Werk oder hängt sie letztlich von etwas ab, das wir selbst tun? Diejenigen, die Letzteres sagen, dass sie letztlich von etwas abhängt, das wir selbst tun, leugnen damit die völlige Hilflosigkeit des Menschen in der Sünde und behaupten damit, dass eine Form des Semi-Pelagianismus doch wahr sei.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass die spätere reformierte Theologie den Arminianismus im Prinzip sowohl als Rückkehr zu Rom verurteilte, weil er den Glauben in ein Verdienstwerk verwandelte, als auch als Verrat an der Reformation, weil er die Souveränität Gottes bei der Errettung von Sündern leugnete, was das tiefste religiöse und theologische Prinzip des Denkens der Reformatoren war. Der Arminianismus war in den Augen der Reformierten in der Tat eine Abkehr vom neutestamentlichen Christentum zugunsten des neutestamentlichen Judentums. Denn sich im Glauben auf sich selbst zu verlassen, ist im Prinzip nichts anders, als sich bei Werken auf sich selbst zu verlassen, und das eine ist genauso unchristlich und antichristlich wie das andere. Angesichts dessen, was Luther zu Erasmus sagt, besteht kein Zweifel daran, dass er dieses Urteil gebilligt hätte.
Und doch ist diese Ansicht heute in bekennenden evangelikalen Kreisen die überwältigende Mehrheit. Und solange der Semi-Pelagianismus, der im Kern einfach eine kaum verhüllte Version des echten Pelagianismus ist, in der Kirche vorherrscht, weiß ich nicht, was passieren wird. Aber ich weiß, was nicht passieren wird: Es wird keine neue Reformation geben. Solange wir uns nicht demütigen und verstehen, dass kein Mensch eine Insel ist und dass kein Mensch eine Insel der Gerechtigkeit hat, dass wir für unsere Erlösung völlig von der reinen Gnade Gottes abhängig sind, werden wir nicht anfangen, uns auf die Gnade zu verlassen und uns an der Größe der Souveränität Gottes zu erfreuen, und wir werden den heidnischen Einfluss des Humanismus nicht los, der den Menschen verherrlicht und in den Mittelpunkt der Religion stellt. Solange wir uns nicht demütigen, wird es keine neue Reformation geben, denn im Mittelpunkt der reformatorischen Lehre steht die zentrale Stellung der Anbetung und Dankbarkeit gegenüber Gott und Gott allein. Soli Deo gloria, Gott allein sei die Ehre.
Anmerkungen
- [1] J. I. Packer und O. R. Johnston, „Introduction“ zu The Bondage of the Will (Old Tappan, NJ: Fleming Revell, 1957), S. 59–60. Deutsch: Vom unfreien Willen (orig.: De servo arbitrio, 1523). Digitalquelle: https://www.theology.de/downloads/deservoarbitrio.pdf [abgerufen 25.03.2025]. – Siehe auch: Scott Clark, Luther über die Freiheit und Knechtschaft des Willens. 6. November 2017. Digitalquelle: https://www.evangelium21.net/media/781/luther-ueber-die-freiheit-und-knechtschaft-des-willens [abgerufen 25.03.2025] .
- [2] ders.
- [3] George Barna (geb. 1954) ist der Gründer von The Barna Group, einem Unternehmen für Marktforschung, das sich auf die Untersuchung der religiösen Überzeugungen und Verhaltensweisen von Amerikanern sowie auf die Schnittstelle zwischen Glauben und Kultur spezialisiert hat.
- [4] »Charles Grandison Finney (* 29. August 1792 in Warren, Litchfield County, Connecticut; † 16. August1875 in Oberlin, Ohio) war ein US-amerikanischer Jurist, evangelikaler Erweckungsprediger, Hochschullehrer und Rektor des Oberlin Collegiate Institute und wichtiger Vertreter der Heiligungsbewegung und des Oberlin Perfektionismus.« (https://de.wikipedia.org/wiki/Charles_Grandison_Finney, abgerufen 14.04.2025).