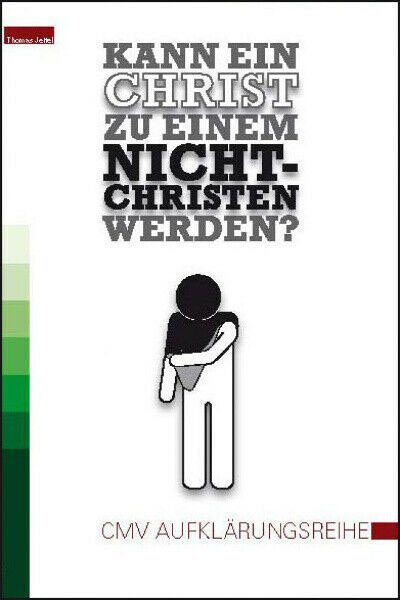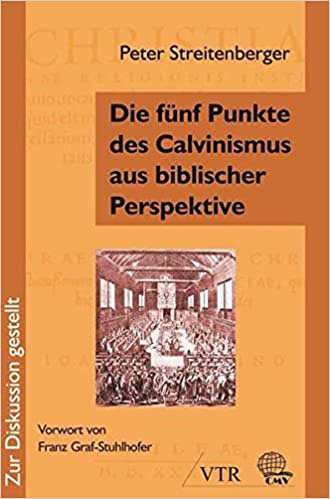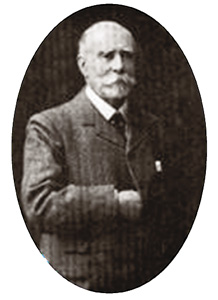Erster Teil hier (Genesis–Exodus), Gesamtdokument (PDF) hier.
Das dritte Buch Mose (Levitikus)
Name und Thema. Das dritte Buch Mose heißt in der hebräischen Bibel nach dem ersten Wort: Wajjiqra’ (»und er rief«). Es ist das Buch der Berufung zur Heiligkeit: Die Heiligen sind dazu berufen, da zu sein, wo er ist (Joh 14,3; 17,23), und so zu sein, wie er ist (1Joh 3,3). Gott selbst bereitet ihnen den Weg in seine Gegenwart und er trifft Vorkehrungen und gibt Weisungen, damit sie für seine Gegenwart passend gemacht sind. Damit kann das Thema des Buches in einem Wort angegeben werden: Heiligkeit (>80-mal). »Denn ich bin Jahwe, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein: So seid heilig, denn ich bin heilig.« (11,45; vgl. 1Pet 1,16).
Zusammenhang. Levitikus ist die Fortsetzung des zweiten Buches, erkenntlich am Anfangswort »Und«. Es knüpft dort an, wo Exodus aufgehört hatte, beim Haus Gottes, und führt dann weiter. In Exodus wurde der Sünder gerettet und zu Gott gebracht, in Levitikus wird der so Erlöste gerufen, nun Gott zu nahen, Gemeinschaft mit Gott zu haben, in sein Haus (Tempel) einzutreten. Diese Gemeinschaft ist möglich durch vermittelnden Priesterdienst – insbesondere des Hohenpriesters – und beständigen Opferdienst. Levitikus ist das Buch der Priester, das Buch der Anbetung. Es ist das Schattenbild dessen, was Petrus so umschreibt: »…auch ihr selbst [werdet] als lebendige Steine aufgebaut, ein geistliches Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, Gott wohlangenehm durch Jesus Christus« (1Pet 2,5; vgl. 2,9 mit der königlichen Priesterschaft).
Es gibt auch bemerkenswerte Unterschiede zwischen Exodus und Levitikus: Anders als in Exodus ruft Gott Mose weder aus dem Dornbusch (2Mo 3) noch von dem Berg Sinai (2Mo 19), sondern er ruft ihn »aus dem Zelt der Zusammenkunft«. Denn dort wohnt Gottes Herrlichkeit und der Erlöste soll zu ihm eingehen; dies ist die höchste Bestimmung der Erlösten. Das dritte und damit mittlere der Mosebücher führt uns damit ins Herz und auf den Gipfel unserer Bestimmung: Wir werden ewig beim Herrn sein, und wir werden ewig den anbeten, der auf dem Throne ist, und das Lamm. Und so wie das Lamm in der Mitte des Thrones Gottes steht (Off 5,6), so steht dieses Buch in der Mitte der fünf Bücher Mose. Der Dreh- und Angelpunkt aller Wege Gottes ist Menschwerdung, Tod und Auferstehung des Herrn Jesus Christus.
Christus (Typologie). Die in den ersten sieben Kapiteln beschriebenen blutigen Opfer sind allesamt ein Schattenbild unseres Herrn, der als Lamm Gottes in diese Welt kam (Joh 1,29), »der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Flecken Gott geopfert hat« (Heb 9,14). Auf Grund dieses Opfers können wir Gott nahen und ihm dienen (Heb 9,14b; 10,19). Er ist aber nicht allein Grund, sondern auch Substanz (Inhalt) und Gegenstand aller Anbetung. Die sich anschließenden Kapitel 8 und 9, welche die Weihe der Priester zum Dienst beschreiben, finden ihre Erfüllung in unserem Hohen Priester Jesus Christus. Er ist nicht allein das Opfer, das Gottes Ehre wiederhergestellt und den Sünder gerechtfertigt hat, sondern er ist auch der Hohe Priester, der allein das Recht und die Macht hat, sich für die Seinen vor Gott zu verwenden, damit diesen sein Opfer zugerechnet wird (Heb 8,1–2). Er ist der Priester, der den Aussätzigen für rein erklären und so vor Gott stellen kann (Kap 13–14): »Und siehe, ein Aussätziger kam herzu, warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte seine Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will; werde gereinigt! Und sogleich wurde er von seinem Aussatz gereinigt.« (Mt 8,2–3). Und er ist der große Sachwalter, der persönlich dafür sorgt, dass alle Sünden seines Volkes vor Gott bekannt und vor Gott gesühnt werden (16,15–16.21–22): »Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt; und wenn jemand gesündigt hat – wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt.« (1Joh 2,1–2).
Merkhilfe
Heiligung – Gemeinschaft mit Gott und untereinander
- 1–10: Wie kann man Gott nahen?
(a) durch den Opferdienst (1–7);
(b) durch den Priesterdienst (8–10). - 11–15: Wie soll man Gott nahen? (Reinheitsgesetze für Nahrung, Krankheit)
- 16–17: Der Große Sühnungstag (jährliches Zentralopfer) und weitere Gesetze
- 18–22: Wie soll man einander nahen? (Reinheitsgesetze für Gemeinschaft)
- 23: Wie feiern wir Seine Gegenwart miteinander? (Feste Jahwes)
- 24–27: Wie sieht die Gemeinschaft der Erlösten aus? (Soziale Verordnungen)
Das vierte Buch Mose (Numeri)
Name und Thema. Das vierte Buch Mose heißt in der hebräischen Bibel wiederum nach einem der ersten Wörter Bemidbar (»in der Wüste«). Es geht um die dem Exodus und der Zeit am Horeb folgende Wüstenwanderung des Volkes Gottes, die wegen vieler Rebellionen (10–25; insbes. 14,22) und fortgesetztem Götzendienst größtenteils (38 der 40 Jahre) ein Irrweg unter Gottes gerechtem Zorn war (vgl. Hes 20,4–26). In diesem Buch des Zornes Gottesfinden sich die uns so geläufigen Geschichten von den Wachteln (vgl. Ps 106,13–15), von der aussätzigen Mirjam, vom geschlagenen Felsen, von den feurigen und von der ehernen Schlange, von Bileam und von Pinehas. Wegen der beiden auffälligen Musterungen und Zahlenangaben bzgl. der ersten (1) und der zweiten (26) Generation (Männliche ab 20 J.) wird das Buch auch »Numeri« (Zahlen) genannt.
Zusammenhang. Numeri ist die zeitlich und vor allem inhaltlich schlüssige Fortsetzung des dritten Buches: Das unter Knechtschaft schmachtende Israel war erlöst und zu Gott gebracht worden, Gott hatte das Volk zu sich gerufen, damit es gleich ihm heilig sei und ihm priesterlich diene. Nun muss Israel als ein von Gott Erwählter, Erlöster und Geheiligter den Weg ziehen, der es durch eine feindliche Welt ans Ziel bringen muss. Sie hätten diesen Weg nicht aus eigener Kraft und eigenem Willen geschafft.
Typologie. Das neutestamentliche Gegenstück wird von Petrus so gesagt: »Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als solche, die ohne Bürgerrecht sind, euch der fleischlichen Begierden zu enthalten, die gegen die Seele streiten, und dass ihr euren Wandel unter den Nationen ehrbar führt, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung« (1Pet 2,11-12). Numeri beschreibt unseren »Wandel unter den Nationen«, spricht von Erprobung und Bewährung (Jak 1,12), von Widersachern und von Kampf, der uns wider diese verordnet ist (Eph 6,12; Jak 4,7; 1Pet 5,8).
Numeri spricht von mannigfaltigem Straucheln (Jak 3,2; vgl. Ps 105), aber auch von Gottes gnädigen Vorkehrungen, welche dafür sorgen, dass Sein Volk trotz Versagen und trotz Verzögerung doch am Ziel ankommt: Er nährt es täglich durch das vom Himmel fallende Manna (vgl. Eph 5,29). Er segnet es priesterlich (6,24–26). Er führt es und ist bei ihm bis an das Ende des Pilgerweges (Mt 28,20). Der von ihm erwählte Hohepriester (17) erhält es in der rechten Beziehung zu Gott und rettet es durch eine feindliche Welt hindurch (Heb 7,25). Den Israeliten war als Erbe ein Land in dieser Schöpfung bereitet; auf uns wartet ein himmlisches Erbe (1Pet 1,4). Dieses Erbe kann uns nicht verloren gehen. Dafür sorgt Gottes Macht und Gottes Treue, worauf der zweitletzte Satz des Buches hinweist: »Und so verblieb ihr Erbteil beim Stamm der Familie ihres Vaters« (36,12b). Gott sorgt dafür, dass wir auf dem Weg durch die Wüste unser Erbe nicht verlieren, wiewohl wir schwach sind wie die Töchter Zelophchads, die, auf sich gestellt, das väterliche Erbe verloren hätten. Allein die Heirat mit einem Mann aus ihrem Stamm (36,5–9) vermochte deren Erbe sicherzustellen. Auch wir, die Braut und die Ehefrau des Lammes, verlören auf unserem langen Weg zum Ziel alles, was uns Gott bereitet hat, hätte sich Christus nicht als unser Bräutigam mit uns verbunden und verbürgte nicht er für die Sicherheit unseres Erbes.
Merkhilfe
Dienst und Wandel auf der Wüstenreise
- 1,1–25,18: Das Ende der ersten Generation in der Wüste (Buchteil 1)
(a) Die Treue Israels am Sinai (1,1–10,10);
(b) Die rebellische Generation in der Wüste (10,11–25,18). - 26,1–36,13: Die neue Generation, Ausblick ins Verheißene Land (Buchteil 2)
(a) Die Vorbereitung der neuen Generation Israels (26,1–30,16);
(b) Die Vorbereitung für Krieg und Einzug ins Verheißene Land (31,1–36,13).
Das fünfte Buch Mose (Deuteronomium)
Name und Thema. Das fünfte Buch Mose heißt in der hebräischen Bibel nach den einleitenden Worten ʾēlleh haddeḇārîm (»Dies sind die Worte«), kurz: Debarim (»die Worte«). Das Thema dieses den Pentateuch (»Fünfbuch«) abschließenden Buches ist die Zuverlässigkeit der Aussprüche Gottes und die Bedeutung dieser Worte im Leben der erwählten Nation, es ist das Buch des ins Herz eingepflanzten Wortes Gottes. Alle Worte Gottes werden sich mit Gewissheit erfüllen, sei es zum Segen, sei es zum Fluch (28). Daher wird dem Volk in jedem Kapitel (und in manchen Kapiteln wiederholt) eingeschärft, auf dieses Wort zu hören, es zu bewahren und ihm zu gehorchen. Der geforderte Gehorsam ist kein rein äußerlicher, sondern Frucht eines durch das Wort Gottes erneuerten Herzens (ca. 47x lêḇâḇ»Herz«; im Pentateuch insges. 55x, im AT 252x). Im Neuen Bund wird dies realisiert werden: »[So] spricht Jahwe: Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben; und ich werde ihr Gott, und sie werden mein Volk sein« (Jer 31,33b; vgl. 2Kor 3,3, Heb 10,10; 15–16).
Das Buch ist nicht, wie der griechische Titel »Deuteronomium« (»zweites Gesetz«) will, eine »Wiederholung des Gesetzes«. Es ist nach (1,5) vielmehr eine Auslegung (be’er) des Gesetzes. Mose liest nicht nur vor, er hält drei Predigten aus dem Wort Gottes (vgl. 2Tim 3,16–4,2). Darin erklärt er dem Volk Gottes, wie ihr Glück sich am (praktischen) Glauben oder Unglauben gegenüber Gottes Wort entscheidet. Zum Beleg liefert er zuerst einen Rückblick über das Ergehen der Kinder Israel seit dem Auszug (1–4). Im Rückblick stellt er dem Volk vor Augen, wie es Gottes Macht zum Fluch erfahren hatte, als es Gottes Wort nicht glaubte (1), danach, wie es Gottes Macht zum Segen erfahren hatte, als es Gottes Wort vertraute (2–3). In den Endkapiteln (28–33) zeigt Mose, dass das Volk eine herrliche Zukunft haben muss, wenn es diesem Wort vertraut und gehorcht, ebenso sicher, wie es eine schreckliche Zukunft haben wird, wenn es diesem Wort nicht vertraut und gehorcht. Mit dem ganzen Gewicht dieses Rückblickes und dieses Ausblickes ermahnt Mose im großen Mittelteil des Buches zum Hören auf Gottes Wort und zum Gehorchen. Das, was man das israelische Glaubensbekenntnis (»Schma Jisrael«, šma‘ yiśra’el = »Höre, Israel!«) zu nennen pflegt, könnte man das Motto des ganzen Buches nennen: »Höre, Israel: Jahwe, unser Gott, ist ein Jahwe! Und du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen auf deinem Herzen sein« (6,4–6).
Zusammenhang. Mit Deuteronomium schließt sich der Kreis, der mit Genesis eröffnet worden war. In Genesis hatten wir erfahren, wie Gottes Wort alles erschaffen und wie die Auflehnung gegen dieses Wort den Menschen in den Ruin gestürzt hatte. In Deuteronomium erfahren wir, wie alle Worte Gottes in Erfüllung gehen und wie Segen oder Fluch sich an unserem Glaubensgehorsam gegen dieses Wort Gottes entscheidet (vgl. bzgl. des Evangeliums, Röm 1,5 und 16,26). Ebenso aber, wie Gott als der souveräne Schöpfer alles nach seinem Willen schuf (vgl. Off 4,11), ohne dass ihn dabei jemand beriet oder er irgend jemandem etwas schuldig war, so wird er am Ende als der souveräne Retter das Heil an einem unwürdigen Volk vollenden (33), das ihm dabei ebenso wenig beraten hat noch ihm etwas gegeben hat, so dass er ihm die Errettung schuldete (Röm 11,34–36). Gott ist das Alpha und das Omega. Er, der im Anfang schuf, wird am Ende alles vollenden. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Typologie und Prophetie. Deuteronomium wird im NT mehr als 40x zitiert und zusätzlich häufig angespielt, auch Christus verwendete häufig Zitate daraus. Israels Sehnen nach einem König wird hier von Moses vorhergesagt (17,14–20). Das Kommen des Herrn Jesus als Prophet wird angekündigt (18,15.18 mit Apg 3,22–23; 7,37). Weiterhin lesen wir von Weissagungen bezüglich der Zukunft Israels. Auffallend oft (21x) wird der von Gott erwählte Ort für den Gottesdienst (»der Ort, wo Gott seinen Namen wohnen lässt«, also persönlich anwesend ist) angekündigt (noch ohne Ortsangabe; es ist Zion, vgl. Ps 132,13–14).
Merkhilfe
Herzensgehorsam gegenüber Gottes Wort (Joh 14,21.23)
- 1,1–5: Vorwort
- 1,6–4,43: Erste Predigt: Der Blick zurück (Wüstenreise)
- 4,44–28,68: Zweite Predigt: Verpflichtungen des Bundesvertrages und dessen Ratifizierung
- 29,1–30,20: Dritte Predigt: Die Bundesbedingungen
- 31,1–34,12: Abschließende Erzählungen
Abschlusszitat zur Inspiration des Pentateuch
»Die modernen Kritiker haben es gewagt, fast alle Bücher der Heiligen Schrift anzugreifen und zu untergraben, allerdings keines mit einer solchen Dreistigkeit wie den Pentateuch (außer vielleicht die Prophetien Daniels). […] Lassen Sie uns an der weitreichenden, tiefgehenden und endgültigen Tatsache festhalten, dass die Autorität Christi diese Frage für jeden, der ihn als Gott und Mensch anerkennt, beantwortet hat.«
William Kelly, Lectures Introductory to the Bible: 1. Pentateuch. Introduction.2
Endnotizen
2– »Modern criticism has ventured to undermine and assail almost all the books of Holy Scripture, but none with such boldness as the Pentateuch, unless it be the prophecy of Daniel. […] Let us take our stand on the fact, broad, deep, and conclusive, that the authority of Christ has decided the question for all who own Him to be God as well as man.« William Kelly (1821-1906), Lectures introductory to the study of the Pentateuch. Chapter 1: Introductory (London: W. H. Broom, 1871), S. VII. VIII . (Textquelle: https://bibletruthpublishers.com/introduction/william-kelly-wk/lectures-introductory-to-the-bible-1-pentateuch/la76920; abgerufen 01.03.2022. PDF: https://www.brethrenarchive.org/media/360163/lectures_introductory_to_the_study_of_the-pent.pdf).
Anhang: Die Offenbarung Gottes im Pentateuch
Jedes Buch des Pentateuch zeigt uns eine besondere Eigenschaften Gottes (s. Tabelle). Natürlich ist Gott stets Derselbe, auch wenn er sich schrittweise und mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung offenbart. Man wird daher in jedem Bibelbuch stets sein ganzes, wahres Wesen sehen können.