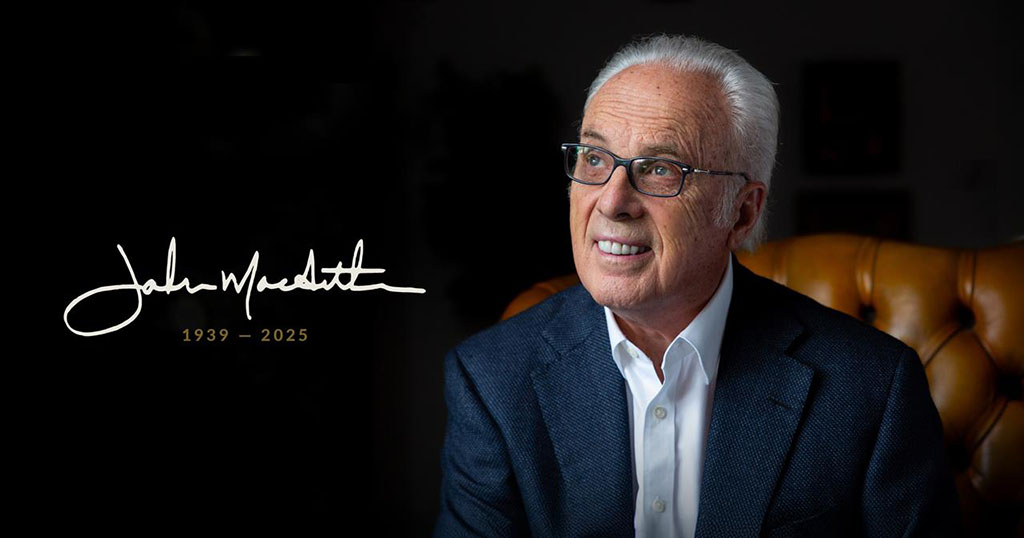Adaptiert von: Jim Stitzinger, Lord, keep us safe… (15.10.2025)
Das gewohnte Gebet von Gläubigen und Ungläubigen gleichermaßen: von Autofahrten bis zu kriegerischen Schlachtfeldern, von Kindern, die zur Schule gehen, bis zu denen, die vor Sportveranstaltungen niederknien – wir beten um Sicherheit und Bewahrung. Es kann ein Schlagwort sein, das wir instinktiv sagen und von ganzem Herzen meinen.
Das Nachdenken über »Was wäre, wenn…?« löst Wellen der Angst, Unruhe und Sorge aus. Unsere Reaktion ist oft, Gott noch eindringlicher zu bitten, uns und unsere Lieben vor Schaden zu bewahren.
Ist es falsch, um Sicherheit zu beten? Nein, schließlich werden wir aufgefordert, unsere Sorgen auf ihn zu werfen, denn er sorgt für uns (1.Petrus 5,7). Es ist auch nicht falsch, sich um Sicherheit zu sorgen, wenn wir gefährliche Pläne verfolgen oder mit der sündigen Natur unserer Welt konfrontiert sind. Warum also dieser Artikel?
Einfach gesagt: Sicherheit und Bewahrung sind nicht unsere oberste Priorität.
Lassen Sie das auf sich wirken: Im Neuen Testament gibt es kein einziges Gebet für Sicherheit. Nicht ein einziges Mal versammeln sich Menschen oder Gruppen, um Gott zu bitten, Johannes den Täufer, Priscilla, Petrus, Lydia oder Paulus »zu bewahren«. Nichts. Es gibt Gebete um Befreiung vom Bösen, aber nichts, was der heutigen Vermeidung von Unannehmlichkeiten entspricht.
Zweifellos waren ihre Herzen von Angst, Schrecken, Trauer und Sorge über ihre Umstände erfüllt. Sie spürten die unmittelbaren Auswirkungen eines Lebens für Christus in einer Welt, die von ungezügeltem Hass gegenüber Gott erfüllt war. Sie waren wahrhaftig Schafe inmitten von Wölfen. Wenn jemand Grund hatte, diese Bitte in seinen Gebeten hervorzuheben, dann war es die verfolgte Kirche. Dennoch finden wir keine Gebete, in denen sie Gott bitten, sie an einen Ort des Komforts, der Leichtigkeit und der Abwesenheit von Not zu bringen.
Das einzige Mal, dass ich finde, dass Paulus dieses Wort verwendet, ist in 2.Timotheus 4,18, und der Kontext ist, dass Jesus ihn sicher durch die Pforte des Todes in den Himmel bringt. Der Herr wird mich von allem Bösen erretten und mich sicher in sein himmlisches Reich bringen; ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen.
Es gibt einige solcher Gebete im Alten Testament (z. B. Psalm 4,8; Psalm 78,53; Jesaja 38,14). Doch selbst unter extremer Verfolgung sehen wir nur sehr selten, dass dies Priorität hat. Denken Sie an alles, was wir über Daniel, Hiob, Esther, Ruth, Jeremia, David und viele andere wissen. Bei all den seelenzerstörenden Emotionen, die sie mit sich herumtrugen, konzentriert sich die überwiegende Mehrheit ihrer Gebete auf etwas anderes als ihr persönliches Wohlergehen.
Wofür beten Gläubige?
- Offene Türen für das Evangelium – Kolosser 4,2-4
- Wachsamkeit und Besonnenheit – 1.Petrus 4,7
- Standhaftigkeit – 2.Thessalonicher 3,3
- Heiligkeit – 1.Thessalonicher 3,13
- Erlösung – Römer 10,1
- Ausrüstung für den Dienst – Hebräer 13,20–21
- Mut – Epheser 6,19–20
- Unterscheidende Liebe – Philipper 1,9
- Liebe, Kraft, Glaube – Epheser 3,16–19
- Weisheit – Jakobus 1,5
- Schutz vor dem Bösen – Matthäus 6,14
- Gerechtigkeit – 1.Petrus 3,10
- Befreiung von Verfolgung, um das Evangelium zu verkünden – Römer 15,31
- Würdiges Leben, göttliche Wünsche, kraftvoller Glaube – 2.Thessalonicher 1,11–12
Ein Argument aus dem Negativen ist nicht unbedingt zwingend. Dennoch geht es in der überwiegenden Mehrheit der Gebete, die in der Schrift vorgelebt werden, viel mehr um die Verherrlichung Gottes als um die Beruhigung unserer selbst. Wenn wir diesem Gedankengang folgen, finden wir heraus, wie wir Gott um den Charakter bitten können, den wir brauchen, um Verfolgung zu ertragen. Sicherlich ist Frieden wünschenswert, aber der Frieden, den Gott verspricht, ist die Realität Christi in uns (Epheser 2,14) und die beruhigende Gewissheit, dass er absolut souverän über alle Dinge ist und alles zum Guten wirkt (Römer 8,28). Der Friede, den er verspricht, kommt nicht dadurch zustande, dass wir der Verfolgung ausweichen, sondern dadurch, dass ER im »Tal des Todesschattens« bei uns ist (Psalm 23, Hebräer 13,5–6).
Unsere Gebete müssen Gottes Prioritäten widerspiegeln. Jesus drückte es so aus: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten (Johannes 14,15). Der gesamte Fokus des christlichen Lebens liegt darauf, Gott durch freudigen, demütigen Gehorsam gegenüber Christus zu verherrlichen.
Gott ist viel mehr an unserer Heiligkeit interessiert als an unserer Gesundheit, an unserer Liebe als an unserer Langlebigkeit, an unserem Charakter mehr als an unserem Komfort, an unserer Heiligung mehr als an unserer Sicherheit. Nicht einmal Jesus betete während seines irdischen Wirkens um seinen persönlichen Schutz. Als er uns lehrte zu beten, sagte Jesus: »Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen« (Matthäus 6,13). Diese Erlösung bezieht sich nicht auf mögliche körperliche Schäden, obwohl diese auch dazugehören können, sondern auf die Auswirkungen verheerender Sünden in unserem Leben.
Der gleiche Gedanke wiederholt sich, als Christus betete: Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, sondern sie vor dem Bösen zu bewahren (Johannes 17,15). Der Schutz, um den wir bitten, ist die beruhigende Gewissheit, von der Paulus in 2.Thessalonicher 3,3 spricht: Aber der Herr ist treu, und er wird euch stärken und vor dem Bösen bewahren.
Wenn Sicherheit unsere oberste Priorität ist, wird unsere Anbetung zu unserer größten Vernachlässigung. Wie können wir mit Christus sagen: »Dein Wille geschehe« (Matthäus 6,10), wenn wir eigentlich meinen: »Solange es meine Lebensqualität oder -quantität nicht beeinträchtigt«. Es ist schwer vorstellbar, dass die drei Hebräer vor Nebukadnezars Götzenbild gestanden und sich geweigert hätten, Gottes Ehre zu kompromittieren, wenn ihre Herzen auch nur im Geringsten um ihre Sicherheit besorgt gewesen wären.
Unsere Sorge um unsere Sicherheit behindert unseren Gehorsam gegenüber dem Missionsauftrag und unsere Bereitschaft, für die Gerechtigkeit zu leiden. Wenn Selbstschutz unsere oberste Priorität ist, gehen wir auf Ungläubige zu, wenn das potenzielle Ergebnis für uns angenehm ist. Dieser Fokus macht uns alle zu Feiglingen.
Wenn unsere Gebete den wahren Prioritäten folgen sollen, dann priorisieren wir unsere Gebete für Heiligkeit, Mut, Treue und Demut und rücken unsere Gebete für Sicherheit an die zweite Stelle. Es ist nicht falsch, unsere Sicherheit und Bewahrung vor Gott zu bringen, aber wir sollten dies nicht zu unserem Götzen machen.
[»Hauptsache gesund!« ist weder christliches Motto noch christliche Maxime.] Schließlich bestimmt Gott den Tag unseres Todes (Psalm 139,16, Hiob 14,5). Das steht schon lange fest. Nichts, was wir tun, kann dieses festgesetzte Datum ändern (Matthäus 6,27). Lebe also in der Freiheit eines Menschen, der bereits gestorben ist und dessen Leben mit Christus in Gott verborgen ist (Kolosser 3,3). Bete darum, dass wir die Zeit, die wir auf Erden haben, nutzen, um den Willen unseres Vaters zu tun, seiner Güte dieser ungläubigen Welt zu zeigen und alle, denen wir begegnen, zur Umkehr und zum Glauben an Christus aufzurufen.
Geoffrey Studdert Kennedy diente während des Ersten Weltkriegs als Feldgeistlicher. Von der Front schrieb er folgende eindringliche Botschaft an seine Familie:
Das erste Gebet, das mein Sohn für mich lernen soll, ist nicht »Gott, beschütze Papa«, sondern »Gott, mache Papa mutig, und wenn er schwierige Aufgaben zu bewältigen hat, mache ihn stark, sie zu bewältigen«. Leben und Tod spielen keine Rolle … richtig und falsch schon.
Ein toter Vater ist immer noch ein Vater, aber ein Vater, der vor Gott entehrt ist, ist etwas Schreckliches, zu schrecklich, um es in Worte zu fassen. Ich nehme an, du möchtest auch etwas über die Sicherheit sagen, alter Kumpel, und Mutter wird das gewiss auch tun. Nun, dann sag es, aber danach, immer erst danach, denn es ist nicht wirklich so wichtig.
Bete also ruhig um Sicherheit und Bewahrung, aber bete es nicht als Erstes.
Endenoten
Adaptiert aus: Jim Stitzinger, Lord, keep us safe… https://thecripplegate.com/lord-keep-us-safe/, 15.10.2025.
Jim Stitzinger: Jim ist Outreach-Pastor an der Crossroads Community Church in Santa Clarita, Kalifornien, USA.
Geoffrey Anketell Studdert Kennedy MC (27. Juni 1883 – 8. März 1929) war ein englischer anglikanischer Priester und Dichter. Während des Ersten Weltkriegs erhielt er den Spitznamen »Woodbine Willie«, weil er den Soldaten, denen er begegnete, Zigaretten der britischen Marke Woodbine schenkte. Er wurde mit dem Military Cross ausgezeichnet dafür, dass er mutig und selbstlos verwundeten und sterbenden Soldaten physische und seelsorgerliche Hilfe leistete.